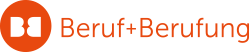Ursula Hauser, Psychoanalytikerin in Costa Rica und Uruguay

«Ich verdiente nichts und lebte von Reis und Bohnen»
Ursula Hauser, Tochter des Gemeindeschreibers von Kilchberg, wurde in den Siebzigerjahren zu einer Pionierin der politisch engagierten Psychoanalyse in Zürich. Die letzten dreissig Jahre lebte die Zürcherin in Nicaragua und Costa Rica, wo sie traumatisierten Frauen half, Depression und Resignation zu überwinden. Nun zieht es die 67-Jährige nach Uruguay.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: ZVG
Kontakt:
ursonio@hotmail.com oder www.fundacionursulahauser.org.
Ursula Hausers Mann Antonio (links) mit Che Guevara.
1963 in Punta de Este, Uruguay.

Frau Hauser, Sie leben seit 30 Jahren in Zentralamerika, vor allem in Costa Rica, wo Sie als Psychoanalytikerin tätig sind. Mehrmals pro Jahr kehren Sie in die Schweiz zurück, um Ihre betagte Mutter zu besuchen. Wie erleben Sie den Kontrast?
URSULA HAUSER: Seit mein Mann vor 17 Jahren gestorben ist, lebe ich alleine in Costa Rica. Ich wollte mir lange nicht eingestehen, dass das gefährlich ist, aber kurz vor der Abreise bin ich zum fünften Mal überfallen und ausgeraubt worden. Diesmal haben sie auch meinen Hund mitgenommen, vermutlich getötet. Deshalb ist für mich die Zeit gekommen, das Land zu verlassen und nach Uruguay zu ziehen. Nach einem solchen Erlebnis schätzt man die Ruhe und die Sicherheit in der Schweiz. Ich habe das Privileg, ein Häuschen mit Seezugang in Oberhofen am Thunersee geerbt zu haben, was wunderbar ist für eine passionierte Alpinistin und Schwimmerin wie mich. Ich merke aber auch, dass ich nicht zu lange in der Schweiz sein kann. Nach einem Monat habe ich jeweils das Gefühl, nicht mehr klar denken zu können, abzustumpfen und meine Schaffenskraft zu verlieren. Wir führen hier ein so apolitisches, von Konsum und Wohlstand bestimmtes Leben.
Das steht im Kontrast zu Ihrem sonstigen Arbeitsalltag. Da engagieren Sie sich in Zentral- und Südamerika sowie Palästina dafür, dass Opfer von Diktaturen und bewaffneten Konflikten ihre Traumata überwinden können. Sind Sie in einem politischen Haushalt aufgewachsen?
Nein, gar nicht. Mein Vater war Gemeindeschreiber in Kilchberg/ZH, wir waren eine brave vierköpfige Musterfamilie, ich das Enfant Terrible. Nach Abschluss meiner Lehrerausbildung ging ich 1966 in die USA. Da geriet ich unvermittelt in den Strudel der Anti-Vietnam-Bewegung und lernte die Arbeit der afro-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Black Panther Party kennen. So wurde ich in kurzer Zeit politisiert. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz geriet ich in eine grosse Sinnkrise. Ich nahm in Zürich eine Psychoanalyse bei Goldy Parin-Matthéy in Angriff. Die vier bis fünf Sitzungen pro Woche kosteten mich ein Vermögen, eröffneten mir aber eine ganz neue Welt. So nahm ich bald ein Psychologie-Studium in Angriff und arbeitete nebenher als Lehrerin und Schultherapeutin. Ich machte zum Beispiel Quartierarbeit im Auzelg, dem «Negerdörfli von Schwamendingen», wie damals alle sagten. Dort setzte ich erstmals das Theaterspiel ein, um Zugang zu den sozial benachteiligten Menschen zu finden.
Paul Parin, seine Frau Goldy und Fritz Morgenthaler gehörten Anfang der Siebzigerjahre in Zürich zu den Vorkämpfern einer politisch engagierten Psychoanalyse.
Ja, Zürich wurde damals im Zuge der 68er-Bewegung eine rote Uni, die Bildnisse von Marx, Lenin, Engels, Mao und sogar Stalin hingen an den Wänden. Die Psychologen und die Architekten revoltierten an vorderster Front gegen die starren akademischen Hierarchiestrukturen. Im August 1969 trafen sich weit über 100 Psychoanalytiker zu einem Kongress in Rom, der den Grundstein legte für eine linke Psychoanalyse, die gesellschaftliches Engagement und internationale Solidarität hoch gewichtete: die Plataforma Internacional. Ich war von dieser Bewegung sehr angetan und wirkte an vorderster Front bei der internationalen Vernetzung mit. Als die «NZZ» berichtete, das Psychoanalytische Seminar Zürich sei «in den Händen von Marxisten», wurde mein Vater in Kilchberg vorwurfsvoll gefragt, ob das wirklich seine Tochter sei, die da zu den Rädelsführern gehöre. Er sagte, es gefalle ihm zwar nicht, was ich mache, ich müsse aber meinen Weg gehen. 1976 wurde das Autonome Psychoanalytische Seminar Zürich gegründet, in Abspaltung von der Internationalen Psychoanalytischen Gesellschaft; es funktioniert bis heute als Selbstverwaltungsbetrieb.
Wann begannen Sie, Theater und Therapie zu verbinden?
Ich suchte seit meinen ersten Erfahrungen mit Quartierarbeit und Schultherapie nach einem solchen Weg. 1971 entdeckte ich die Psychodrama-Methode des österreichisch-amerikanischen Arztes Jacob Levy Moreno und nahm eine Ausbildung in Überlingen in Angriff. Moreno hatte als Psychiater in Wien beobachtet, welch günstige therapeutische Wirkung es hatte, wenn er Strassenkindern mit einem Trauma aus dem Ersten Weltkrieg erlaubte, den Krieg in verschiedenen Rollen nachzuspielen. Während die Psychoanalyse ganz von den Verbalisierungsfähigkeiten abhängig ist, erlaubt das Psychodrama allen, sich über ihren Körper zu äussern. Ich habe das eindrücklich erlebt in einem Projekt mit Bauerntöchtern aus dem Tösstal, welche durch ihre Verstocktheit erfahrene Psychiater zur Verzweiflung gebracht hatten. Im Rollenspiel taute eine wortkarge 27-Jährige rasch auf, als sie eine Kuh spielen durfte. In diesem selbstvergessenen Zustand sagte sie plötzlich: «Und jetzt kommt dann mein Vater vorbei, um mich zu melken.» Ohne den Rollentausch hätte sie nie von der beklemmenden Inzestgeschichte erzählen können.
Warum gingen Sie Anfang der Achtzigerjahre nach Nicaragua?
Ich wollte ja gar nicht auswandern, aber von den vielen lateinamerikanischen Psychoanalytikern, die in Europa im Exil lebten, wusste ich, wie dringend die Menschen in diesen Ländern therapeutische Hilfe gebrauchen konnten, erhielten sie doch in den Spitälern in aller Regel einfach Psychopharmaka in rauen Mengen. So ging ich 1980 für zwei Jahre nach Nicaragua, auf Anfrage des sandinistischen Gesundheitsministeriums. Ich verdiente nichts und lebte von Reis und Bohnen, aber ich musste mich keinen Moment fragen, ob das sinnvoll war, was ich tat. Dann lernte ich in Nicaragua meinen Mann kennen, einen Ingenieur aus Uruguay, der dort Windmühlen bauen wollte. Gemeinsam zogen wir weiter nach Costa Rica. Mein Mann wollte nicht nach Uruguay zurückkehren, solange jene, die ihn in den Siebzigerjahren gefoltert hatten, nicht zur Rechenschaft gezogen worden waren. Ich begann, an Universitäten in Kuba, Mexiko und Costa Rica zu arbeiten und schrieb mit 48 Jahren eine Doktorarbeit in Ethnopsychoanalyse.
Was war Ihr Hauptanliegen?
Es gibt zwei Hauptaspekte. Zum einen wollte ich dazu beitragen, dass traumatisierte Frauen einen Ausweg aus Depression und Resignation fanden und wieder auf ihre Ressourcen vertrauen konnten. Da ist es enorm hilfreich, wenn sie im surrealistischen Raum belastende Dinge durchspielen und in verschiedenen Rollen erleben können. In El Salvador etwa konnte ich mit Hilfe der NGO «medico international Schweiz» 15 Frauen, Ex-Guerrilleras und zum Teil Analphabetinnen, in Psychodrama ausbilden, die jetzt mit der sozialistischen Regierung zusammenarbeiten. So entstand ein Raum, in dem Frauen sich mit ihren traumatisierenden Kriegserlebnissen auseinandersetzen können.
Und der zweite Aspekt?
Ich möchte Menschen dazu befähigen, sich in ihrem Kontext zu begreifen, klar zu denken und Selbstverantwortung zu übernehmen. Ein Beispiel: Die vier Enkel meines verstorbenen Mannes haben wie die meisten Kinder in Uruguay keine Ahnung, warum sie ihren Grossvater nie kannten, warum die Mutter so oft Migräne hat und weshalb das Land so heruntergewirtschaftet ist. Die Menschen finden mit ihrer Identität keinen Anschluss an die Geschichte, weil ihre Eltern schweigsam wurden während der Diktatur. Reden war verboten. Psychodrama ist ein gutes Instrument, die Geschichte aufzuarbeiten aus subjektiver Warte.
Sie fordern die jüngste Generation auf, spielerisch Staatsstreich, Militärputsch und Folter durchzugehen?
Ja. Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten – nur so gelingt es, nicht Opfer der Geschichte zu bleiben. Es bringt nichts, nur wie die alte Linke moralisch zu richten, sondern es kommt aufs Verstehen und Überwinden an. Das gilt bei weitem nicht nur für Uruguay. Haben denn die Chilenen, Argentinier, Mexikaner, Spanier und Italiener verstanden, was die Diktatur in ihren Ländern angerichtet hat und wie diese Zeit sie weiterhin prägt?
Sie sind jetzt 67-jährig – denken Sie manchmal an den Ruhestand?
Nein, ich breche jetzt zu einem neuen Abenteuer in Uruguay auf. Zudem bilde ich Ärzte, Psychiater, Sozialarbeiter und Krankenschwestern in Palästina in Psychodrama aus. Da ich kinderlos bin, habe ich Anfang Jahr eine Stiftung gegründet, damit das alles nicht einfach versandet, wenn ich einmal nicht mehr da bin.
3. August 2013