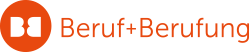Beat Zaugg, Unternehmer in der Sportartikelbranche

«Man sollte sich nie in die Gegenwart verlieben»
In der Bäckerei seiner Eltern hat Beat Zaugg gelernt, was harte Arbeit ist. Später hat er sich mit Fleiss und taktischem Geschick beim Sportartikelhersteller Scott hochgearbeitet, bis ihm die Firma gehörte. Nun hat er die Hälfte des Unternehmens nach Südkorea verkauft, um mehr finanziellen Spielraum zu haben. «Ich habe mich nie geschont und bin öfter ein hohes Risiko eingegangen», sagt Zaugg im Rückblick auf seine Tellerwäscher-Karriere.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Kontakt und weitere Informationen:
www.scotts-sports.com
Herr Zaugg, haben Sie als Kind davon geträumt, reich zu werden?
Nein, da stand anderes im Vordergrund. Bessere Schulnoten zum Beispiel. Oder das erste Töffli. Eine Lektion habe ich allerdings früh gelernt: Dass sich hartes Arbeiten auszahlt. Meine Eltern führten in Bern eine Bäckerei. Sie waren sieben Tage pro Woche im Geschäft, frühmorgens in der Backstube, danach im Laden. Mein Bruder und ich halfen in den Ferien mit und verdienten so unser Taschengeld.
Ein Bäckerssohn wird Alleininhaber der Firma Scott Sports und verkauft später einen Teil der Aktien für 100 Millionen Franken. Wie war so eine Tellerwäscherkarriere möglich?
Ich habe mich nie geschont und bin öfter ein hohes Risiko eingegangen. Als Skiakrobat bin ich früh mit Sportartikeln in Berührung gekommen. Und schon mit 23 Jahren zeigte sich, dass ich keine halben Sachen mag. Ich gehörte zu den zehn besten Skiakrobaten der Welt im Skiballett, hatte aber keine Chance, die Nummer 1 zu werden. Das stand in keinem Verhältnis zu meinem Aufwand und zum Schmerz, den ich in Kauf nahm. Deshalb hörte ich mit 23 auf.
Wie kamen Sie vor 30 Jahren zur Firma Scott?
Nach meiner Bauzeichner-Lehre arbeitete ich ein Jahr beim Sportgeschäft Vaucher, danach vier Jahre bei der Modeboutique Kitchener. Dort lernte ich viel über den Handel: dass man nie Mittelmass sein darf, immer etwas Spezielles bieten muss. Dann begann ich bei Scott in Givisiez, damals ein 12-Mann-Betrieb, der Skistöcke und -Brillen produzierte. Bald konnte ich eine interessante Aufgabe in der Produkteentwicklung in Italien übernehmen.
Woher konnten Sie italienisch?
Ich sprach kein Wort italienisch, stand mit allen Sprachen auf Kriegsfuss. Für meine Französischlehrerin war ich eine Zumutung. Einmal sagte sie zu mir: «Ich mache mir nur deshalb keine Sorgen um Sie, weil ich sicher bin, das Sie eines Tages eine Sekretärin haben werden.» In Italien lernte ich die Sprache rasch. Jeden Morgen zwei Stunden Privatunterricht und eine hohe Motivation: das hilft!
Wie wurden Sie vom Mitarbeiter zum Grossaktionär der Firma?
Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In einer wachsenden Firma gibt es immer neue Möglichkeiten, aber auch viel Unruhe. Manche finden das anstrengend, für mich war es ein Glücksfall. Ich konnte dank meiner Beziehungen mithelfen, das Velo-Business aufzubauen. 1990 setzte sich mein Chef dafür ein, dass ich mit allem Geld aus dem Sparkässeli ein Prozent von Scott kaufen konnte. Drei Jahre später übernahm ein externer Investor die Mehrheit, der Europa-Chef wechselte in die USA. So entstand hier in Givisiez ein Machtvakuum und ich konnte mehr Verantwortung übernehmen.
1998 übernahmen Sie auf einen Schlag einen 33-Prozent-Anteil. Woher hatten Sie das Geld?
Ich hatte das Geld nicht – wäre ich mit der Firma gescheitert, hätten mich allein die Anwaltsrechnungen in ernsthafte Probleme gebracht. Aber Geld ist nicht alles, ebenso wichtig sind Unabhängigkeit, Schaffenskraft und klare Ziele. Ich hatte keine Kinder, kein teueres Leben. Also sagte ich mir: «Mit 40 kannst du ein Management-Buy-Out riskieren, mit 50 machst du das nicht mehr.» Klar, ich hatte kein Harvard-Studium und keine Erfahrung mit Firmenkäufen, aber ich kannte die Produkte, den Markt, die Kunden. Und die Credit Suisse glaubte an meine Pläne und gab mir Kredit.
Hatten Sie schon da das Ziel, das Unternehmen ganz zu übernehmen?
Nein, ich war sehr zufrieden und dachte, so würde es nun für die nächsten 30 Jahre bleiben. Heute bin ich klüger und weiss: Spätestens alle fünf Jahre verändern sich die Dinge grundlegend. 2002 erhielten wir ein attraktives Übernahmeangebot einer Beteiligungsgesellschaft. Alle im Verwaltungsrat wollten einwilligen, nur ich stellte mich stur dagegen. So erhöhte ich meinen Anteil erst auf 51,5 und drei Jahre später auf 100 Prozent. Weitere fünf Jahre später hatte ich alle Schulden zurückbezahlt.
Warum haben Sie danach in zwei Tranchen wieder 50,01 Prozent von Scott an die südkoreanische Firma Youngone verkauft?
Wer im Leben etwas bewahren will, verliert es mit grosser Wahrscheinlichkeit. Man sollte sich nie in die Gegenwart verlieben, sondern die Zukunft gestalten. Ein weltweit agierendes Unternehmen mit 500 Millionen Franken Umsatz allein zu besitzen, bindet sehr viele Mittel und ist ein Klumpenrisiko. Zudem müssen wir 5 bis 10 Prozent pro Jahr wachsen, um unserem jungen Team gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten zu können. Als Schweizer Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln sind wir in Asien, dem wichtigsten Wachstumsmarkt, weniger stark als die asiatische Konkurrenz. Also erreichen wir unsere Ziele besser mit einem starken asiatischen Partner. Youngone ist börsenkotiert und macht 1,3 Milliarden Franken Umsatz, wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen.
Was bedeutete der Verkauf der Mehrheit für Sie persönlich? Allein die 30-Prozent-Tranche hat Ihnen im Februar dieses Jahres rund 100 Millionen Franken eingebracht. Damit hätten Sie eigentlich ausgesorgt.
Ich habe 25 Jahre lang jeden freien Rappen in die Firma investiert. Nun habe ich dank des Geldes erstmals die Möglichkeit, Neues anzupacken. Ich hatte nie im Sinn, Privatier zu werden und Golf zu spielen. Geld bedeutet für mich die Freiheit, unternehmerisch aktiv zu sein – das ist mir lieber, als von der Arbeit befreit zu werden. Vor langer Zeit versprach ich meiner Frau, ab 45 beruflich kürzer zu treten. Nun bin ich 57-jährig und habe das Versprechen noch immer nicht eingelöst. Vielleicht ist das ein Grund, warum unsere Beziehung noch so gut funktioniert. Ich will Chancen erkennen, Risiken eingehen, meinen unternehmerischen Geist ausleben – das war immer mein grösster Luxus.
Leute, die Sie gut kennen, sagen, niemand sei bereit, so sehr zu leiden für den Erfolg wie Sie.
Das klingt mir zu heroisch. Man kann auch an Langeweile leiden. Das Schlimmste ist, wenn Menschen in jungen Jahren zu viel Geld haben und es sich in der Komfortzone bequem machen. Ich war früh viel unterwegs und verlange auch meinen Führungskräften viel ab in dieser Hinsicht. Die effizienteste Art zu reisen ist, im Flieger zu schlafen und am Tag Geschäfte zu machen. Da spart man das Hotel und ist schneller wieder zurück. Aber ich bin keiner, der pausenloses Arbeiten glorifiziert. Mehr als 10 Stunden pro Tag kann keiner am Stück konzentriert arbeiten. Man soll sich nicht kaputt machen, aber man soll sich und anderen viel abverlangen.
Sie haben die neuen finanziellen Freiheiten genutzt, um von Andy Rihs die Hamburger Rad-Marke Bergamont, von der Italienischen Tecnica-Gruppe den Outdoor-Ausrüster Dolomite und in Down Under das Fahrradunternehmen Sheppard zu kaufen. Kann man daraus schliessen, dass Sie vor allem in diesen Bereichen Wachstumspotenzial sehen?
Ja, im hochpreisigen Rad-Segment können wir weiter wachsen, ebenso in den Sparten Bekleidung und Schuhe. Deshalb haben wir zusätzlich die Europa-Lizenz des US-Outdoorausrüsters Outdoor Research übernommen. Im Wintersport sind die Märkte sehr gesättigt, da ist Wachstum nur noch via Verdrängung möglich.
Sie verkaufen nicht direkt, sondern über 20 000 Fachhändler auf der ganzen Welt. Ist es nicht bedrohlich, dass ich als Kunde mein neues Velo auch über Plattformen wie Amazon oder Galaxus kaufen kann, ohne je einen Laden zu betreten?
Die Digitalisierung erhöht zweifellos den Druck auf den Fachhandel. Der Kunde ist besser informiert und preissensibler. Das E-Business hat aber seine Grenzen, es führt zu vielen Fehlkäufen und Rücksendungen. Gerade im höheren Preissegment braucht es weiterhin gute Beratung durch Spezialisten. Aber die Fachhändler müssen effizienter werden und ihre Internetpräsenz verstärken. Unternehmen wie Intersport oder Sportscheck zeigen, dass das geht.
Im September haben Sie den Outdoorausrüster Transa gekauft. Was haben Sie mit der Marke vor?
Das war eine Gelegenheit für ein privates Investment, das nichts mit der Scott-Gruppe zu tun hat. Ich spiele dort keine aktive Rolle und möchte mich nicht weiter dazu äussern.
Haben Sie im Sinn, weitere Firmen zu kaufen?
Bei Scott sind wir nun gut aufgestellt, da steht die Integration im Vordergrund. Privat habe ich noch zwei, drei Karten im Ärmel, da könnte noch das eine oder andere Liebhaberobjekt dazukommen.
Worauf sind Sie stolz, wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken?
Dass ich immer meine Rechnungen zahlen konnte. Und dass ich nie meine Werte verraten, mir untreu geworden bin. Ein harter Stier-Schädel lässt sich nicht so leicht von seinem Weg abbringen.
Welchen Rat würden Sie jungen Berufsleuten mit auf den Weg geben?
Immer wieder Neues zu wagen und Risiken einzugehen. Wir sind in der Schweiz unheimlich privilegiert. Nicht nur können die meisten lernen, was sie wollen, sondern sie haben dank unseres dualen Berufsbildungssystems auch die Möglichkeit, umzusatteln und es in einem Zweitberuf weit zu bringen. Viele Jugendliche in anderen Ländern wären froh, sie könnten überhaupt einen Beruf lernen und ausüben. Dieses Privileg gilt es zu nutzen.
12. Dezember 2015