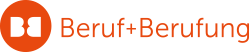Christoph Trummer, Musiker

«Ich weiss... ich kenne das... du bist nicht allein»
Der Musiker Christoph Trummer (35) hat einen weiten Weg zurückgelegt: Zunächst von Frutigen im Berner Oberland via New York nach Bern. Dann in den letzten zwei Jahren durch Kenia, Tunesien, Osteuropa und den Balkan. Zeit für einen Zwischenhalt und ein Gespräch über schmerzhafte Verluste, heitere Melancholie und die Herausforderung, Songs zu schreiben, die Freundschaftsdienste leisten.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: Viktor Golikov
Kontakt und weitere Informationen:
www.trummeronline.ch

Für das neue Projekt «Heldelieder» sammelt Trummer online Unterstützungsbeiträge.
Sie leben seit 10 Jahren hauptsächlich von der Musik. Wann war Ihnen klar, dass Sie ein Musiker sind?
CHRISTOPH TRUMMER: Ich wurde Musiker, ohne mich bewusst dafür zu entscheiden. Mein Vater spielte schon als Siebenjähriger im Posaunenchor Frutigen, mein Grossvater war dort ebenfalls aktiv. Ich lernte früh Trompete und später Gitarre. Lieder machte ich irgendwie schon immer. Ich erinnere mich nur noch, dass ich in der siebten Klasse erstmals das Gefühl hatte, nun sei mir ein richtiges Lied gelungen, eines, das mein Gefühl einfängt und wiedergibt. Es ging, wen wunderts, um Liebeskummer.
Sie sind in Frutigen in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen. Hat Ihnen niemand gesagt, Sie müssten zuerst etwas Rechtes lernen?
Ich neigte früh schon dazu, andere zu unterhalten, ein Publikum zu suchen. Mit dieser narzisstischen Komponente hatte ich manchmal Mühe. Aber dann sagte ich mir, entscheidend sei es, die Zeit der Leute nicht zu verschwenden, ihnen etwas Substanzielles zu geben. Ich liebäugelte mit drei Berufen: Schriftsteller, Musiker oder Prediger. In allen drei Fällen war klar, dass ich nicht gleich nach der neunten Klasse damit beginnen konnte. Also absolvierte ich das Lehrerseminar. Und die Musik hat sich dann nach und nach durchgesetzt.
Meldet sich der Prediger in Ihren Liedern ab und an noch zu Wort?
Ich hoffe nicht. Ich glaube zwar an absolute Wahrheiten, aber nicht an die Möglichkeit, diese in Worte zu fassen. Für mich haben jene Texte etwas Heiliges ,welche die Wahrheit des Menschseins abbilden. Dies zu versuchen, wäre dann wohl heute meine Mission. Ich glaube, es war Bob Dylan, der sagte, ein guter Song sei wie eine Taschenlampe, die verborgene Nischen im Estrich ausleuchtet und etwas sichtbar macht, was immer schon da war, aber kaum gesehen wurde.
Leuchten Ihre Lieder wirklich einen Estrich aus oder nicht viel eher die eigene Biografie?
So richtig ausleuchten kann man wohl nur seinen eigenen Estrich. Man schöpft als Künstler hauptsächlich aus dem Fundus der eigenen Erfahrungen. Aber Privates ungefiltert in Liedern zu verarbeiten, finde ich uninteressant. Es ist ein schmaler Grat zwischen Aufrichtigkeit und «too much information». Ich glaube allerdings schon, dass man dann berührt, wenn man auch das eigene Berührt-Sein zugibt.
Haben Sie ein Beispiel für so eine Erfahrung, die Ihre Musik geprägt hat?
Meine Eltern sind beide früh gestorben. Ich war 19, als ich meinen Vater verlor, 22, als meine Mutter starb. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, explizit den Verlust meiner Eltern zu beschreiben in meinen Liedern. Aber weil die Kunst für mich der Ort ist, wo eine differenzierte Auseinandersetzung mit allen Facetten des Lebens stattfindet, ist es klar, dass die Verlust-Thematik in meiner Musik einen wichtigen Platz hat.
Man hat Sie oft als Grübler oder Melancholiker bezeichnet.
Ich sehe daran nichts Falsches, solange man damit nicht meint, ich sei chronisch deprimiert. Melancholie ist eine nachdenkliche Perspektive auf das Leben, die aber nicht zwingend finster und negativ sein muss. Melancholische Kunst hat ebenso ihre Schönheit wie etwa die verspielte Art eines Jean Tinguely.
Haben Sie sich je gefragt, ob Sie ein anderer Künstler geworden wären ohne den frühen Verlust der Eltern?
Ich habe mir eher die Frage gestellt, was mit mir geschehen wäre, wenn ich diese Erfahrung nicht in meiner Musik hätte verarbeiten können. Ich war beim Schritt ins Erwachsenenleben stark auf mich gestellt, ein wichtiger Teil des Loslösungsprozesses fiel weg, es gab kein Echo von zuhause, keine Eltern, die sich Sorgen machten. Ich war dadurch auf eine seltsame Art frei – und misstraute dieser Freiheit lange, weil ich dachte, irgendwann komme noch der Zusammenbruch. Wenn ich heute meine Songs von damals betrachte, sehe ich, dass ich mich dem gestellt habe, dass die Gefühle von Verlust und Vergänglichkeit gut aufgehoben waren in den Liedern. Ich habe keine Ahnung, was ich ohne Musik damit gemacht hätte.
Warum haben Sie zu Beginn konsequent englisch gesungen?
Zu Beginn meiner Karriere gab es noch keine Mundartwelle, richtig bekannt war eigentlich nur Polo Hofer; Züri West und Patent Ochsner waren da erst im Kommen. Da war es naheliegend, dass ich meinen englisch singenden Helden wie Jeff Buckley nacheiferte. Weil meine Musik stark von den Texten lebt, hatte ich irgendwann den Drang, dort aufzutreten, wo das Publikum alle Nuancen versteht, und zog für eine Zeit nach New York. Ich wurde gut aufgenommen in den USA, aber ich hätte lange gebraucht, um dort heimisch zu werden. Und ich bekam Lust, Lieder zu schreiben für meine Welt, in meiner Sprache.
Zuhause ist meistens die Kritik unerbittlicher. Manche monieren, Ihre Texte seien...
...nicht besonders geheimnisvoll, ich weiss. Ich will mein Publikum nicht mit Wortkunst beeindrucken, sondern einen direkten Austausch ermöglichen. Deshalb bin ich lieber volkstümlich als zwanghaft originell. Es ist gut, wenn meine Songs schon beim ersten Mal grundsätzlich verstanden werden. Wenn man sich einlässt, gibt es hinter den Geschichten tieferliegende Ebenen. Dorthin muss man wollen. Mein Ton ist sicher nicht jedermanns Sache. Es gibt kompetente Musikkritiker, die mit meinen Liedern nichts anfangen können. Zum Glück erhalte ich auch viele positive Rückmeldungen, die das kompensieren. Wenn jemand mir schreibt, sie sei zu einer längeren Reise aufgebrochen und habe als Verbindung zur Heimat eine Platte von mir im Gepäck, ist das ein schönes Kompliment. Es ist ein Geschenk, wenn meine Lieder zu einem Gegenüber werden, mit dem man unterwegs sein kann.
Gab es auch Selbstzweifel?
Es war nicht so, dass mir in der Schule alle gesagt hätten, meine Stimme sei so schön, ich müsse unbedingt singen. Ich habe mir das Singen eher erkämpft und etwas ganz Passables aus meiner Stimme gemacht. Aber manchmal denke ich: Richtig gut singen zu können, das wäre schon cool. Dann tröste ich mich jeweils damit, dass Bob Dylan und Leonard Cohen auch keine Grossmeister des Wohlklangs und reinen Intonierens waren. Von den Altvorderen wäre keiner in die letzte Runde des Casting-Wettbewerbs Musicstar gekommen.
Ihr neues Projekt «Heldelieder» macht Sie zum Buchautor, der in die Migrationsdebatte eingreift. Ist das eine komplette Neuausrichtung?
Nein, das ist mein Weg vorwärts. Ich habe in den letzten zwei Jahren längere Reisen gemacht, durch Kenia, Osteuropa, den Balkan und Tunesien. Daraus entsteht nun ein multimediales Werk über Begegnungen von Menschen unterschiedlichster Herkunft. Es ist ein relativ unpolitischer, aber empathischer Beitrag zur Migrationsfrage. Mir liegt daran, Menschen und ihre Herkunft zu zeigen – auch den zum Rassismus neigenden Schweizer an seinem Stammtisch. Zunächst geht es ums Hinschauen und Erzählen, dann ums Verstehen. Und natürlich bedeutet Verstehen nicht, alles zu entschuldigen. Tatsächlich habe ich nicht nur die Songs, sondern auch szenische Texte geschrieben; das Ganze kommt im Februar als Buch mit Zeichnungen des Illustrators Gefe und einem Anhang von Kontextinformationen heraus. Aber ich habe mich dagegen gewehrt, auf dem Klappentext als Schriftsteller angekündigt zu werden. Das wäre ein zu grosses Wort.
Sie sammeln im Internet Geld für die Finanzierung des Projekts. Ist das auch als Eingeständnis zu verstehen, dass Künstler wie Sie nicht mehr von Konzerten und CD-Verkauf leben können?
Ich arbeite seit Jahren 40 Prozent als Angestellter und 60 bis 150 Prozent als Künstler. Insofern ist das nichts Neues. Aber es ist klar, dass der CD- und Download-Markt nicht mehr viel hergibt. Gleichzeitig sind dank Community-Bildung im Internet neue Marktchancen entstanden. Ich finde es schön, dass wir via Crowdfunding ein aufwendiges Projekt wie «Heldelieder» mitfinanzieren können, aber es ist für die Musikindustrie natürlich kein Rezept gegen die Schäden, welche die Internet-Piraterie anrichtet. Schwarmfinanzierung im Internet ist kein Geschäftsmodell, bei mir mag es erfolgsversprechend sein, weil ich schon zehn Jahre im Musikbusiness bin, 2039 Facebook-Freunde habe und vor allem ein treues Publikum, das bereit ist, für etwas Werthaltiges zu bezahlen.
Ihr Publikum wäre grösser, wenn Sie einen Pop-Hit schreiben würden statt der Migration nachzuspüren oder frutigdeutsche Gedichte zu vertonen.
Mein Ehrgeiz geht eher dahin, ein viel beachtetes Werk herauszugeben, das von meiner Auseinandersetzung mit der Welt zeugt. Ein extrem populärer Titelsong kann zur Hypothek werden für ein Album, für eine ganze Laufbahn. Mir liegt mehr daran, das Leben zu kartografieren. Was bekomme ich denn von den Künstlern, die ich verehre? Am ehesten doch das Gefühl, dass da einer den Arm um meine Schulter legt und zu mir sagt: «Ich weiss.. Ich kenne das. Du bist nicht allein.» Wenn meine Musik für ein paar Leute diese Funktion hat, ein wenig zum Soundtrack ihres Lebens wird, dann bin ich glücklich. Zudem bewahre ich mir die Hoffnung, dass viele, die meine Musik mögen würden, sie noch gar nicht entdeckt haben.
23. November 2013