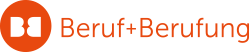Cynthia Odier, Kunstmäzenin

«Es tut gut, von Zeit zu Zeit verletzt zu werden»
Seit 10 Jahren hält Cynthia Odier die Genfer Kunstszene mit ihrem «Flux Laboratory» in Atem. Nun hat sich die in Ägypten geborene Griechin im Zürcher Schiffbau eingemietet, um Wirtschaft und Kunst auf eine neue Art zusammenzubringen. «Kunst ist ein Katalysator. Sie kann helfen, verkrustete Strukturen aufzubrechen», sagt die Frau des höchsten Schweizer Bankers.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: ZVG
Kontakt und weitere Informationen:
www.fluxlaboratory.com oder agenda@fluxlaboratory.com
Frau Odier, Sie sind die Frau des höchsten Bankers der Schweiz und Kunst-Mäzenin. Das klingt, als dürften Sie einfach das Geld ausgeben, das Ihr Mann verdient.
CYNTHIA ODIER: Das ist nicht falsch. Die Frage ist, was man daraus für Schlüsse zieht. Als ich in Genf vor gut zehn Jahren mit dem Kunstprojekt «Flux Laboratory» begann, wurde ich nicht ernst genommen. Die traditionsbewussten Genferinnen und Genfer tun sich schwer mit Innovationen, sie reagieren erst einmal mit Desinteresse oder Ablehnung. Die Leute hier hätten mich lieber irgendwo in einer Boutique gesehen. Das hat mich verletzt – aber es tut gut, von Zeit zu Zeit verletzt zu werden. Daraus erwächst zusätzliche Energie. Ich mietete eine ehemalige Schlosserei, um dort in sehr unterschiedlichen Räumen Kunst-Events zu veranstalten. Als Mäzenin gab ich jeweils nur die Thematik vor und liess den angestellten und eingeladenen Künstlern freie Hand bei der Umsetzung.
Sie investierten jährlich rund eine halbe Million Franken in das Projekt. Was soll dieses Geld bewirken?
Kunst ist ein Medium der Verständigung über elementare Themen. Gerade eine relativ verschlossene Gesellschaft wie jene in Genf braucht frische Impulse von aussen. Ich schuf eine Plattform für den Austausch zwischen Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Natürlich gab es jede Saison ein neues Programm, aber wir blieben immer offen für spontane Aktionen. Wir holten auch zahlreiche Unternehmen an Bord. Es gab Kunstperformances bei KPMG, sogar ein Tanzprojekt mit den Auditoren, um deren Körpersprache zu verbessern.
Vor einem Monat haben Sie ein neues Projekt im Zürcher Schiffbau lanciert. Ist das die beste Möglichkeit, Ihren Mann regelmässig zu sehen, der als Präsident der Bankiervereinigung und Vize-Präsident von Economiesuisse oft in Zürich tätig ist?
Das spielte tatsächlich in meine Überlegungen hinein. Als mein Mann mir sagte, er gedenke seine Aufgaben weiterzuführen, hatte ich zwei Optionen: In Genf sitzen und mich bedauern oder in Zürich etwas aufbauen. Zum Glück gab es gute Argumente für das neue Projekt in Zürich. Ich will hier Kunst und Wirtschaft auf eine neue Art und Weise zusammenbringen. Viele Unternehmen stecken in einer Identitätskrise. Sie können die Kunst als Kommunikationskanal nutzen.
Das passiert doch schon lange. Jede Bank hat ihre Kunstsammlung, jede Versicherung sponsert Kulturanlässe.
Ja, aber das sind alles relativ isolierte Aktionen. Man macht ein wenig Sponsoring, ein wenig Mäzenatentum, ein wenig Marketing, ein bisschen Werbung mit Kunstsujets, ein wenig Mitarbeitermotivation und Innovationsworkshops – und in allen Bereichen werden derzeit die Budgets gekürzt. Ich will die Unternehmen dazu motivieren, vermehrt ein Kunstprojekt zu unterstützen und dies in der ganzen Kommunikation einzusetzen. Es macht einen grossen Unterschied, ob man mittels echter Kunst kommuniziert oder einfach einen Werbefilm dreht. Und ob man Kreativität zu befehlen versucht oder sie durch Kunst anregt. Den Unternehmen kann ernsthafte Konfrontation mit der Kunst nur gut tun, weil viele sich neu erfinden müssen – da ist Kunst ein grosser Katalysator. Und viele Künstler sind bereit, mit Firmen zusammenzuarbeiten, Konzessionen zu machen.
Braucht Kunst nicht maximale Freiheit?
L’art pour l’art? Das ist nur ein Teil des Kunstbetriebs. Kunst weitet den Blick, verschafft einen anderen Zugang zu einzelnen Themen – warum soll die Wirtschaft nicht davon profitieren? Es gibt keine absolute Freiheit. Wir leben alle in wechselnden Abhängigkeiten. Entscheidend ist, dass wir im Kopf frei bleiben. Gegen Kooperationen und Kompromisse ist nichts einzuwenden. Ein Beispiel: Wenn Sie den Eingangsbereich einer Bank betreten, dann haben Sie doch das Gefühl, sie seien in einem Gefängnis. Warum sollten nicht Künstler helfen, in dieser erstarrten Welt etwas zu bewegen? Die Wirtschaft dachte lange Zeit, sie habe immer das letzte Wort und könne alles mit Geld und Macht regeln. Jetzt verliert diese Welt an Gewicht, das zeigt sich in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Kunst kann helfen, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, die Auseinandersetzung mit wichtigen Themen in Gang zu bringen. Jedes Unternehmen bräuchte ein «Laboratoire Flux», einen Raum, in dem hauptsächlich über Emotionen kommuniziert wird. Viele Geschäftsleute wissen ja gar nicht mehr, wer sie sind – sie versuchen bloss noch, unter immer grösserem Druck ihre Rolle zu spielen.
Man kann sich schlecht vorstellen wie Sie beim Diner sitzen mit den Geschäftspartnern Ihres Mannes.
Wissen Sie, warum ich rauche? Damit ich bei Diners ab und zu aufstehen und an die frische Luft gehen kann. (Lacht) Aber ich mag die Konfrontation mit anderen Welten. Ich habe eine ganz andere Geschichte als mein Mann, das macht es ja so spannend. Wir lernen beide viel.
Sie sind Griechin, kamen als Kind aus Ägypten in die Schweiz. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen?
Meine Eltern immigrierten aufgrund der politischen Situation in Ägypten in die Schweiz, um uns Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Wir waren überhaupt nicht wohlhabend, kamen mit einem Koffer und vielen Tränen nach Genf. Meine grosse Passion war der Tanz – mit 16 Jahren wurde ich in Genf ins Ballet du Grand Théâtre aufgenommen. Ich heiratete jung, wurde Mutter, lebte später in Lateinamerika und Chicago, wo ich als Tanzlehrerin und Kommunikationsberaterin arbeitete und meine drei Kinder aufzog. Das war eine schwierige Zeit, auch finanziell. Nachträglich sehe ich darin viel Gutes. Ich lernte viel, aber es fehlte mir der Freiraum, eigene Träume zu realisieren. In den USA traf ich erstmals Patrick Odier, und er sagte zu mir: «Du solltest deinen Traum leben können und das tun, was du unbedingt willst.» Ich antworte ihm: «Manchmal geht das eben nicht.» Aber ich vergass seine Bemerkung nicht. Jahre später, in Genf, öffnete mir der Zufall viele Türen. Patrick und ich begegneten uns wieder, wir waren beide ungebunden, und er schenkte mir die Möglichkeit, meine Kunst- und Tanzprojekte umzusetzen.
Welche Ziele verfolgen Sie heute?
Zunächst setze ich alles daran, das «Flux Laboratory» in Zürich zum Erfolg zu bringen, auch ökonomisch. Bis jetzt war es so, dass einige Unternehmen die Kunst punktuell nutzten für die Lancierung von Produkten, die Kundenpflege oder die Weiterbildung, aber daraus keine langfristigen Projekte entstanden sind. Das soll sich ändern. Mittelfristig möchte ich mich noch mehr gemeinnützig engagieren. Dafür braucht es aber mehr als Geld. Es geht darum, so zu geben, dass der Empfangende nicht sein Gesicht, seine Würde verliert. Vor einem Monat wurde ich in Athen in einem chicen Quartier von einer älteren Frau angesprochen. Sie sagte mir, sie habe kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Sie hätte meine Mutter sein können. Ich schämte mich, ihr einen Geldschein zu geben. Als ich es dann doch tat, wollte sie mir zum Dank ihren Hochzeitsring überreichen. Auch in Griechenland würden künstlerische Interventionen auf der Strasse viel zur Entkrampfung beitragen.
Ist jemand, der nichts zu essen hat, empfänglich für Kunst?
O ja, Kunst ist eine Emotion, sie ist überall. Kunst kann in schwierigen Zeiten eine Ventilfunktion haben und heilsam wirken. Die Kunst hilft uns auch, die Vielschichtigkeit der Dinge zu erfassen. Sie kann uns dafür sensibilisieren, dass wir alle Gebende und Empfangende sind. Griechenland ist finanziell angeschlagen und braucht Unterstützung, das ist richtig. In anderen Bereichen können wir aber viel von den Griechen lernen, etwa in Sachen Lebensfreude oder im Umgang mit älteren Menschen. Die Gesellschaft wird immer älter, und wir delegieren die Betreuung Betagter an Spezialisten in Pflegeheimen und Spitälern. Da kommt eine gewaltige Last auf uns zu. In Griechenland leben die alten Menschen mehrheitlich in ihren Familien – auch das wäre Stoff für ein Kunstprojekt!
11. Mai 2013