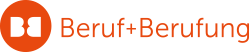Ekkehard Kuppel, Mangementberater

«Ich war erfolgreich, aber tendenziell schlecht gelaunt»
Nach 25 Jahren in diversen Chefetagen dämmerte es Ekkehard Kuppel, dass er nicht nur Erfolge ermöglicht, sondern auch einige Probleme mitverursacht hatte. Der Manager realisierte, dass er zwar viel von Strukturen und Strategien verstand, aber wenig über sich selber wusste. Nach einem schmerzhaften Lernprozess unterstützt er nun andere Führungskräfte darin, mehr innere Klarheit zu gewinnen.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Kontakt und weitere Informationen:
www.sumpeople.ch oder office@sumpeople.ch
Herr Kuppel, warum sind Sie Manager geworden?
EKKEHARD KUPPEL: Eigentlich wollte ich Geographie studieren, aber die Berufschancen sahen damals nicht sehr rosig aus. Pflichtbewusstsein und Leistungsorientierung wurden in meinem Elternhaus sehr hoch gehalten. Dementsprechend verlief auch meine Entwicklung: Studium zum Wirtschaftsingenieur an der Technischen Universität Karlsruhe, danach Promotion an der Hochschule St. Gallen. Beim Beratungsunternehmen McKinsey fand ich eine willkommene Karriereleiter. Ich konnte aufsteigen, ohne mich auf eine Industrie oder Funktion festlegen zu müssen. Nachdem ich dort Partner geworden war, setzte ich mir das Ziel, Chef zu werden. Ich wurde zunächst CEO von «20 Minuten», dann bei der Jacobs AG und schliesslich bei Adecco Human Capital Solutions. Ich habe überall hart gearbeitet, war nach landläufigen Massstäben erfolgreich, aber tendenziell schlecht gelaunt.
Woher rührte die schlechte Laune?
Das war mir gar nicht richtig klar. Ich hielt es für normal – schliesslich ist Business keine Spassveranstaltung. Ich definierte mich stark über meine Position; wenn mich jemand fragte, wer ich sei, antwortete ich typischerweise mit dem Titel auf meiner Visitenkarte. Das klang zwar erfolgreich, aber erfüllt war ich nicht.
Wann begannen Sie umzudenken?
Mitte 40, während der – man muss es wohl so nennen – Midlife Crisis. Diese zeigte sich auch auf Nebenschauplätzen, etwa durch die Teilnahme am New York Marathon oder die Privatfluglizenz, die ich damals erwarb. Wir lebten in New York und ich hatte den Auftrag, für Adecco das Beratungsgeschäft aufzubauen. Ich fädelte eine Reihe von grösseren Übernahmen ein; die Geschäfte nahmen Schwung auf, an der Oberfläche lief alles ganz gut. Über eine Transaktion lernte ich den früheren MIT-Professor Fred Kofman kennen. Er öffnete mir mit einem einfachen Dreieck die Augen: It-We-I. It steht für Zahlen, Strukturen, Strategien, die harten Faktoren; We für Zusammenarbeit, Kultur, Vertrauen; I schliesslich für Fragen wie: Wer bist Du? Warum machst Du, was Du machst? Mir wurde klar, dass ich in den 25 Jahren als leistungsorientierter Manager gut 95 Prozent meiner Zeit ins ‚It’ gesteckt hatte – und auf der We- und der I-Dimension grossen Nachholbedarf hatte.
Für diese Erkenntnis brauchte es einen Professor?
Meine argentinische Frau hatte mich schon länger ermutigt, die Beziehungsebene und die Selbstreflexion zu stärken, aber ich muss zugeben, dass ich das von ihr nicht annehmen konnte und der Durchbruch erst mit dem einfachen Modell des renommierten Professors kam. Ich hatte mich bis dahin immer als exzellenten Problemlöser gesehen. Durch die Gespräche mit Fred Kofman wurde ich offen für die Frage, wie ich selbst zu den vielen Problemen beigetragen hatte, die ich anschliessend durch harte Arbeit aus dem Weg räumte.
Berater Reinhard Sprenger sagte an dieser Stelle: «Manager beschäftigen sich zu 90 Prozent ihrer Zeit mit Problemen, die sie selber erzeugt haben.»
Da ist etwas Wahres dran, auch wenn er wohl übertreibt. Aber ich mag sein Zitat: «Whenever I have a problem I am around.» Mir wurde jedenfalls klar, dass mich mein extremer Fokus auf Zahlen und Strukturen in der Zusammenarbeit mit anderen limitierte. Mir dämmerte auch langsam, wie ich zu Konflikten in der Konzernleitung oder im Verwaltungsrat beigetragen hatte. Die Erkenntnis wuchs, dass ich an mir selbst arbeiten musste. So akzeptierte ich die Position eines Managing Directors in der Beratungsboutique von Professor Kofman. Dort lernte ich viel über die We- und die I-Dimension, in bisweilen schmerzhaften Prozessen, Feedback- und Coaching- Gesprächen.
Sind Sie aus der Business-Welt ausgestiegen?
Nein, ich bin kein Aussteiger. Das Interesse am Business, an der It-Dimension, habe ich nie verloren. 2011 gründete ich meine eigene Firma: sum. Sum steht im Latein für «ich bin», im Englischen für «Summe», Kanton-Chinesisch für «Herz». Wir unterstützen heute Führungskräfte und Geschäftsleitungen, die WE- und die I-Ebene in ihr Tun zu integrieren. Wir helfen auch, ganzheitlicher über die It-Dimension nachzudenken. Wir stellen die Frage nach dem Warum. Warum gibt es euer Unternehmen? Welchen Beitrag leistet ihr? Mir gefällt der englische Begriff Purpose. Um diesen Purpose erfolgreich zu verfolgen, braucht es meistens Veränderungen der Kultur und der eingeschliffenen Verhaltensweisen: mehr zuhören, mehr unterstützen, mehr lernen. Der CEO und die Geschäftsleitung müssen hier als Vorbilder vorangehen, sonst braucht man gar nicht damit anzufangen. Natürlich kann man ausschliesslich über Druck, Angst und Finanzzahlen führen und so kurzfristig Ziele erreichen; mittelfristig führt das aber zu grossen Kollateralschäden und man schöpft das volle Potenzial des Unternehmens und seiner Mitarbeiter nicht aus.
Warum kommen Manager meistens erst in der zweiten Lebenshälfte zu dieser Erkenntnis? Etwas ketzerisch könnte man sagen: Wer vorher als nimmermüder Problemlöser genug Geld verdient hat, kann es sich dann leisten, sich als Berater selbständig zu machen und ganzheitliche Führungsgrundsätze zu predigen.
Ich bin kein Prediger. Was mir machen, ist vermutlich auch nicht für jedermann. Aber wir erleben eine stark wachsende Anzahl von Führungskräften, die ihre Art zu führen hinterfragen. Wir helfen ihnen dabei, tiefer zu schürfen als auf der Zahlenebene. Das wird häufig sehr persönlich. Zahlreiche Führungskräfte erkennen erst in der zweiten Lebenshälfte, dass sie – ähnlich wie ich selbst – die We- und vor allem die I-Dimension sträflich vernachlässigt haben. Das hat nicht nur fürs Berufsleben Konsequenzen. Um dem wachsenden Interesse an der I-Dimension Rechnung zu tragen, habe ich mit meinem Freund Schoscho Rufener «Mountain Wisdom» ins Leben gerufen. Wir laden Topmanager in die Berge ein und verbringen 2,5 Tage mit Fragen wie: Wer bin ich? Warum tue ich, was ich tue? Die Tage beginnen dort mit Yoga, nicht mit Joggen; der Blick ist nach innen gerichtet, nicht auf die Märkte. Eine Übung ist beispielsweise, die eigene Grabrede zu schreiben oder die Lebensgeschichte in sechs Wörtern zu formulieren. Für viele Teilnehmer ist es das erste Mal, dass sie sich solche Fragen stellen. Sie schätzen den offenen und intensiven Austausch mit Gleichgesinnten.
«I help executives take their heart to work», lautet Ihr Motto. Wie kommt das bei rationalen Managern an?
Verzeihen Sie den Ausflug ins Englische. Es fällt mir schwer, auf deutsch vom Herzen im Business-Kontext zu reden. Aber genau darum geht es. Ich erlebe in unserem Workshops, wie das gegenseitige Vertrauen wächst, wenn am Abendessen Geschichten erzählt werden, wenn hartgesottene Führungskräfte Verletzlichkeit zeigen und wenn man in kleinen Gruppen gemeinsam an den wichtigen Fragen arbeitet anstatt Powerpoint-Schlachten anzuzetteln. Persönlich staune ich, wie viel Positives sich in den letzten Jahren ergeben hat, das ich nie hätte planen können. Seit ich meinen Purpose verfolge, scheint eine unsichtbare Hand dafür zu sorgen, dass ich mit den richtigen Menschen in Kontakt komme. Ich arbeite immer noch sehr viel, bin weltweit unterwegs und lerne immer wieder, dass hinter jeder leistungsorientierten Führungskraft auch ein Mensch steckt, mit Wünschen und Zweifeln und der Sehnsucht nach Sinn und Beziehung.
Was ist der grösste Unterschied zum früheren Leben als Manager?
Ich bin gelassener geworden aus den erwähnten Gründen. Vieles fällt mir heute zu, während ich früher um alles hart gekämpft habe. Apropos Gelassenheit: Über Mountain Wisdom habe ich einen jungen Pfarrer, Patrick Schwarzenbach, kennengelernt; er promoviert über Meister Eckhart. Dieser Mystiker hat im 13. Jahrhundert den Begriff Gelassenheit in die deutsche Sprache gebracht, in seiner Doppelbedeutung von «loslassen» und «sich einlassen». Und ich trage seinen Namen – ob das nur Zufall ist?
24. Oktober 2015