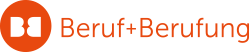Hellmut Schümperli, Vermögensverwalter und Sänger

«Mit 22 Jahren hatte ich das Kapitel Karriere abgeschlossen»
Seine Jugend war so wild, dass der Lehrer den Dorfpfarrer vorbeischickte. Später wurde Hellmut Schümperli Trouble Shooter beim US-Börsenmakler Merrill Lynch und machte sich mit 22 Jahren als Personalvermittler selbständig. Heute verwaltet der 58-Jährige mit der eigenen Firma Finaport über 1,5 Milliarden Franken Kundengelder – und tritt nebenbei als Sänger in Kellertheatern auf.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Kontakt und weitere Informationen:
www.finaport.com oder www.hellmut.com
hellmut.schuemperli@finaport.com
Die neue CD:
Herr Schümperli, hatten Sie Pläne für Ihr Leben oder hat Sie früh der Zufall an der Hand genommen?
HELLMUT SCHÜMPERLI: Ich hatte schon meine Vorstellungen, meine Eltern auch – und das passte furchtbar schlecht zusammen. Meine Eltern mussten mit wenig Geld auskommen, der Vater arbeitete auf der Gemeinde, die Mutter verdiente mit Nachtwache im Spital und Reinigungen dazu. Natürlich sollte es der Sohn besser haben, sprich: ins Gymnasium gehen, studieren, doktorieren.
Wie weit sind Sie gekommen auf diesem vorgezeichneten Parcours?
Ich blieb im Gymnasium auf der Strecke, weil ich den Kopf voller Flausen hatte und wenig motiviert war, Latein zu büffeln. In dieser Zeit realisierte ich, dass ich es einfach nicht schaffte, den Eltern zuliebe ein guter Schüler zu werden. Meine Mutter reagierte verständnisvoll und sagte, ich solle doch tun, was mir Spass mache. Ich nahm sie beim Wort und lebte mein Leben in Cliquen und WGs. Ab und zu ging ich nach Hause, um einen Teller Spaghetti zu essen. Als 15-Jähriger lebte ich im Wesentlichen für eine Sache: die Auftritte mit unserer Rockband am Mittwoch, Samstag und Sonntag Abend. Ich arbeitete zwischendurch bei Studer Revox, um zu lernen, wie man Lautsprecher baut und Mischpulte verdrahtet. Es war eine stürmische Jugend – einmal schickte der Lehrer sogar den Dorfpfarrer bei meinen Eltern vorbei zur Ermahnung.
Wie sind Sie mit dieser Vorgeschichte zu einem Praktikum bei der Schweizerischen Volksbank gekommen?
Der erste Wunsch war, eigenständig zu sein und meinen eigenen Weg zu gehen. Dafür war die Rockmusik perfekt. Allerdings konnte ich mich immer schlechter mit den Randerscheinungen dieser Szene identifizieren. Das ungesunde Leben – bis tief in die Nacht auf den Beinen und dann bis Mittag im Bett bleiben – das ging für mich nicht auf die Dauer. Mit 16 war mir klar: Ich will mein Leben in die eigenen Hände nehmen, ich brauche einen Challenge für den Kopf. Deshalb löste ich mich von dieser Szene los, absolvierte auf eigene Kosten die Handelsschule und begann hoffnungsvoll bei der Volksbank. Dort wurde ich von einer tschechischen Coiffeuse in den internationalen Zahlungsverkehr eingearbeitet – ziemlich ernüchternd. Ich absolvierte die Rekrutenschule und wechselte als Wertschriftenbuchhalter zu Merrill Lynch. Nach entsprechender Weiterbildung avancierte ich zum Trouble Shooter. Allerdings war ich zu ehrgeizig, um lange in dieser Position zu verharren, und zu jung, um aufzusteigen. So kam es, dass ich mit 22 Jahren das Kapitel Karriere abschloss und mich selbständig machte.
Wie funktionierte das?
Ich verkaufte Wohnungseinrichtung und Auto und legte auf sieben Quadratmetern als Personalvermittler los. Durch die Tätigkeit bei Merrill Lynch wusste ich sehr genau, wie die Banken organisiert waren und wo es Schwachstellen gab. Da es zu dieser Zeit keine auf Banken spezialisierten Personalvermittlungen gab, hatte ich einen guten Start. Und bald wagte ich mich auf die Teppichetage vor.
Vertrauten die arrivierten Geschäftsleute einem 24-jährigen Jungspund?
Es gab schon den einen oder anderen peinlichen Moment. So hatte ich in der NZZ gelesen, dass ein Bankdirektor aus Genf einen Job in Zürich suchte. Forsch lud ich den Herrn zum Mittagessen in der Kronenhalle ein. Als er mich sah, wollte er gleich wieder gehen. Ich demonstrierte Selbstbewusstsein, setzte mich mit ihm zu Tisch und bestellte zweimal Canard à l’Orange. Es waren die längsten 45 Minuten meines Lebens, bis diese Ente endlich auf unserem Tisch war. Weil uns schon 40 Minuten vorher der Gesprächsstoff ausgegangen war, hatte ich meine Nervosität nicht mehr im Griff. So entglitt mir die Ente, als ich sie mit Messer und Gabel bearbeiten wollte, und verschmutzte den teuren Anzug meines Gegenübers grässlich. Mein Kandidat erhob sich und entfernte sich wortlos.
Aber sonst liefen die Geschäfte gut?
Ja. In den Anfängen wurde ich zwar ein paar Mal gefragt, ob der Papa keine Zeit habe, weil die Kunden dachten, ich vertrete den richtigen Headhunter. Aber mit der Zeit baute ich mir einen guten Kundenstamm auf. Mitte der Achtzigerjahre verkaufte ich die Firma an eine Mitarbeiterin. Irgendwie war ich trotz allem bei der Musik stecken geblieben. Ich baute ein Tonstudio, begann zu komponieren und Musik für Interpreten aus der Schweiz und Deutschland aufzunehmen. Als die Musikproduktion zum Beruf wurde, kam mir leider rasch die Freude abhanden. War ich vorher immer dankbar gewesen für die Ventilfunktion der Musik, verlor ich rasch den Elan und die Kreativität.
Und aus Langeweile kauften Sie Häuser und Firmen zusammen?
Nein, so kann man das sicher nicht sagen. Ich konnte damals aus dem Konkurs einer Beteiligungsfirma einige Benetton-Läden, eine Schmuckkette und Anteile an einer Schinkenfabrik übernehmen. Darüber hinaus kaufte ich eine Chemische Reinigung. So hatte ich plötzlich etwa 40 Angestellte, war Financier und Ideengeber. Wir eröffneten in den folgenden beiden Jahren einige weitere Geschäfte, allerdings war ich dabei kaum ins Tagesgeschäft integriert.
Es träumen doch viele davon, nicht mehr täglich rennen zu müssen...
Eines Tages, als ich am hellheiteren Tag vor unserem Haus am oberen Zürichsee dem Gärtner bei der Arbeit zuschaute, sagte meine Frau zu mir: «Jetzt kontrollierst du also, ob der Gärtner alles richtig macht. Du wirst krank, wenn du so weiterfährst.» Sie hatte Recht. Man idealisiert das immer, wenn man von denen spricht, die es geschafft haben, nicht mehr kämpfen müssen, es sich gut gehen lassen. Für mich war es eine Qual. Also stürzte ich mich als Ein-Mann-Unternehmen zurück in meinen angestammten Bereich, die Personal- und Unternehmensberatung für Banken. Bald hatte ich wieder sieben oder acht Mitarbeiter und kaufte schliesslich die Personalberatungsfirma Ledermann mit 40 Leuten dazu.
Wer finanziell weich gepolstert ist, kann leichter Risiken eingehen...
Ich glaube, es ist eher eine Frage der Mentalität. Als ich mich mit 22 Jahren selbständig machte, hatte ich wenig zu verlieren. Später drängte es mich immer wieder, Neues auszuprobieren statt Bestehendes zu verwalten. Früher hatte ich keine Angst, auch dann nicht, wenn es riskant war. Mit zunehmendem Alter, mit Familie und Verpflichtungen, steigt aber auch das Sicherheitsbedürfnis – der Schritt ins Unternehmertum wird daher immer schwieriger.
Waren Sie erfolgreich mit Ledermann?
(Lacht) Die neue Firma flog mir, kaum hatte ich sie gekauft, um die Ohren. Die Finanzkrise Ende der Achtzigerjahre brach mit voller Wucht über uns herein. Innert weniger Wochen wurden fast alle Mandate von den Banken annulliert. Da ist es dann rasch einmal vorbei mit der weichen Polsterung. Ich hatte alles, was ich besass, in die Firma gesteckt, das Einfamilienhaus, die Ferienwohnung, das Ersparte. Ich war mir nicht sicher, ob die Krise zu überstehen war, aber nach drei, vier Jahren machten wir mit zwölf hoch qualifizierten Mitarbeitern um die Hälfte mehr Umsatz als vorher mit 50 Leuten.
Und als die Firma saniert war... suchten Sie das Weite.
Das ist eine provokative Formulierung. Ich sah, wie sich die Banken Mitte der Neunzigerjahre zu IT-Molochen entwickelten, wie sehr die Datenverwaltung und -sicherung zu einem zentralen Thema wurde. Fusionswellen kamen auf uns zu. Bei meinen damaligen Kollegen stiess ich aber auf Granit mit dem Anliegen, in diesen Bereich zu investieren. So gründete ich mit drei Partnern von Fides und der Credit Suisse eine neue Firma, welche nebst Personalvermittlung auch IT-Projektleitungen und Strategieberatung anbot. Meine Kernaufgaben waren Strategieberatung fürs Private Banking und Executive Search. Immer öfter verzweifelte ich jedoch an der Veränderungsresistenz der Banken. 2006 hatte ich die Nase voll und sagte mir: Wenn niemand an meine Ideen glaubt, setze ich sie eben selber um. So gründete ich 2007 mit Alex Borissov, der bei der Bank UBP den Bereich Zentral- und Osteuropa geleitet hatte, die Firma Finaport. Nach bald sieben Jahren gehören wir wahrscheinlich zu den Top 20, vielleicht sogar zu den Top 10 in der Schweiz.
Woraus leiten Sie das ab?
Wir verwalten zwischen 1.5 und 2 Milliarden Franken Kundenvermögen und wachsen in einem schrumpfenden Markt jedes Jahr in einem höheren zweistelligen Bereich. An den vier Standorten Zürich, Singapur, Hong Kong und Miami arbeiten rund 40 Leute für Finaport.
Lohnt sich das für den Kunden? Vor kurzem war wieder im «Spiegel» von einer Studie zu lesen, die belegen soll, dass auf lange Sicht Indexfonds bessere Ergebnisse liefern als der Rat von teuren Anlageprofis. Und dass man noch besser fährt, wenn man einen Affen Dartpfeile werfen lässt und so sein Aktienportfolio zusammenstellt.
Auf Aktien haben wir in diesem Jahr bis Anfang September über 15 Prozent Rendite erwirtschaftet. Damit sind unsere Kunden sehr zufrieden. Aber ich glaube auch nicht an die grossen Magier, die immer richtig liegen. Unser Vorteil neben dem hohen Fachwissen ist, dass wir unabhängig und sehr schnell sind. Konkret: Viele Banken sind auf den Verkauf ihrer eigenen Finanzprodukte angewiesen. Der Kundenberater möchte das zwar ändern, aber er ist häufig machtlos, weil die Anreizsysteme so ausgerichtet sind. Bei einer uns allen bekannten Grossbank wurden zeitweise bis zu 93 Prozent eigene Produkte in die Kundenportfolios gebucht.
Was machen Sie anders?
Wir behandeln unsere Mitarbeiter wie Kleinunternehmer, deren wichtigste Aufgabe es ist, die jeweils optimale Lösung für ihren Kunden zu finden. Grossbanken segmentieren ihre Kundschaft, manche Dienstleistungen bieten sie manchen Kunden gar nicht erst an. Wir sind eine zentrale Anlaufstelle für jede Art von Bankdienstleitungen. Manches machen wir selber, für anderes suchen wir den besten Partner. Weil wir erst 2007 operativ begonnen haben, gibt es bei uns keine Leichen im Keller und auch keine Krise. Wir haben mit allen Banken die gleichen Konditionen und überwachen vollelektronisch bei jedem Kunden die Performance und diverse weitere Parameter. Wenn ich vorhin sagte, wir seien schnell, dann meine ich das so. Als 2008 die Kurse abstürzten, verkauften wir kurzfristig alle Positionen und wandelten sie in Cash um. Von den anschliessend tiefen Kursen haben wir dann beim Rückkauf bestens profitiert. Wenn man die Situation nicht mehr versteht, muss man sofort rausgehen. Für eine Grossbank ist der Ausstieg aus allen Portefeuilles unmöglich.
Der Bankenplatz Schweiz ist enorm unter Druck geraten. Spielt die Musik heute in Singapur?
Im Private Banking ist der Bankenplatz Schweiz nach wie vor das Beste, was der Kunde wählen kann – bezüglich Geschwindigkeit, Fachwissen und Transparenz. Das kann ich auch in Asien mit Stolz vertreten – ich muss mich jedenfalls nicht verkleiden oder verstecken, wenn ich dort unterwegs bin. Singapur wächst, das ist klar, aber Singapur kopiert immer noch die Schweiz, nicht umgekehrt.
Als Geschäftsführer einer expandierenden Finanzboutique hatten Sie in den letzten Jahren viel zu tun. Blieb da noch Zeit für die Musik?
Ja, das war über all die Jahre ein wichtiger Pfeiler in meinem Leben. Ich hatte privat mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. Um diese zu verarbeiten, produzierte ich vor längerem eine CD mit Rockballaden. Später fragte DJ Antoine an, ob er einen meiner Songs übernehmen und leicht modernisieren dürfe. In den letzten Monaten habe ich intensiv an einer neuen CD gearbeitet. Zwölf Songs in Schweizerdeutsch, die ich mit vier anderen Musikern eingespielt habe. Dieser Tage dürfte die CD auf den Markt kommen – oder sagen wir, erhältlich sein; ob es einen Markt dafür gibt, weiss ich nicht. Unabhängig davon bin ich stolz auf die Texte. Es ist kondensierte Lebenserfahrung, keine Begleitmusik. Ein Song ist ein Joke auf das Banker-Dasein und die Bonusdiskussionen, ein anderer ist dem Ausbildungszwang gewidmet. Da heisst es unter anderem: «Vo Druck und Ehrgiz programmiert, en Wäg, wo inen Irrtum füert...»
12. Oktober 2013