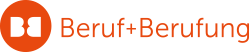Marc Gassert, Kampfkünstler und Experte für Disziplin

«Die wichtigste Regel lautet: Hör auf zu jammern»
Weil sein Vater international Verbrechen bekämpfte, wuchs Marc Gassert in unterschiedlichen Kulturen auf. Treue Begleiterin war in all den Jahren die Liebe zur Kampfkunst. So wurde aus dem bayrischen Lausbub ein Meister der Disziplin und Willenskraft. Der 39-Jährige erläutert im Interview, warum Jammern eine Sünde ist und wie er seinen Kung-Fu-Lehrmeister enttäuschte.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Kontakt und weitere Informationen:
www.marcgassert.deoder info@marcgassert.de

Das Buch: Marc Gassert: Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Ariston Verlag 2013.
Herr Gassert, Ihr Vater war Experte für Entführungen bei Interpol und Mafiajäger. Wie sehr hat das Ihren eigenen Weg geprägt?
MARC GASSERT: Ich bin ganz behütet aufgewachsen – es standen halt immer ein paar Hühnen in Armani-Anzügen vor dem Haus und ich spielte eher im Garten als auf der Strasse. Einer der Bodyguards – wir nannten ihn Onkel Ju – unterrichtete mich in Kampfkunst. Bei ihm lernte ich, mich aus Umklammerungen zu befreien und davonzurennen.
Was wussten Sie über die Tätigkeit Ihres Vaters?
Darüber weiss ich bis heute wenig. Damals in Rom hat er mit Giovanni Falcone die Rote Brigade bekämpft. Als Kind gab ich mich mit dem Gefühl zufrieden, er sei eine Art Polizist, der für das Gute einsteht. Die Gefahr, die davon für uns alle ausging, war mir nicht wirklich bewusst. Prägend waren die vielen Umzüge. Im Rückblick war das Fluch und Segen zugleich. Natürlich war es mühsam, immer wieder entwurzelt zu werden. Ich entwickelte dadurch aber die Fähigkeit, mich als Fremder rasch zurechtzufinden und zu integrieren. Wenn man als blonder deutscher Jüngling in Rom, Venzuela, Japan oder China ankommt, gerät man leicht in die Rolle des Sonderlings und Aussenseiters. Ich entging diesem Schicksal durch meinen Humor und vor allem durch sportliche Leistungen.
Wie kommt es, dass Sie schwarze Gürtel in Karate, Taekwondo und Kung Fu erworben haben?
Ich erwarb mit zwölf Jahren den ersten Meistergrad in Taekwondo. Später erhielt ich ein Stipendium für ein Studium in Japan, wo koreanische Kampfkünste nicht sehr beliebt sind. Also erlernte ich den schwarzen Gürtel in Shotokan Karate. Nach Abschluss des Studiums kam ich schliesslich mit der ZEN-Praxis in Kontakt, der philosophischen Grundlage der Karatekampfkunst. Ich entschloss mich, die Quelle dieser Tradition, den Shaolin-Mönchsorden in der chinesischen Provinz Henan, aufzusuchen und mich dort in Kung Fu unterrichten zu lassen.
Wie schwierig war die Anpassung an fremde Kulturen für Sie?
Ich hatte im Hauptfach Kommunikationswissenschaft studiert, im Nebenfach Interkulturelle Kommunikation, war also theoretisch gut vorbereitet auf alles. In der Praxis war es trotzdem eine grosse Herausforderung. Die japanische Kultur beispielsweise kann man sich nicht rein kognitiv erschliessen. Man muss in sie eintauchen und die Widersprüche aushalten. So kam ich mit dem 65-jährigen Chef des grossen Telecom-Unternehmens NTT DoCoMo in Kontakt. Es stellte sich heraus, dass er in Rom studiert und im gleichen Viertel gelebt hatte, wie ich aufgewachsen war. Beim Schwärmen über die italienische Kultur legte er die typisch japanische Förmlichkeit komplett ab. Der tränenreiche Abend gipfelte darin, dass wir uns betranken und verbrüderten. Am nächsten Tag sah mich der gleiche Manager nicht mehr an und sprach nur noch über einen Untergebenen mit mir. Ich war sehr verletzt und begriff erst viel später, dass er sich demonstrativ von mir distanzieren musste, weil er meinetwegen zu viele Emotionen gezeigt hatte in der Öffentlichkeit.
Lange Zeit war die Kampfkunst die einzige Konstante in Ihrem Leben. Was haben Sie beim Kämpfen übers Leben gelernt?
Durch die Kampfkunst wird man zu schonungsloser Selbsterkenntnis gezwungen. Schon mit zwölf Jahren lernte ich, dass der Kampf die Begegnung zweier Kräfte mit dem Ziel der Versöhnung ist. Es geht nicht darum, den Gegner zu besiegen, sondern darum, dass er dir deine Schwachstellen zeigt und du dazulernen kannst durch ihn. Kung Fu bedeutet wörtlich: Ergebnis harter Arbeit. Diese Einstellung, mir die Dinge hart zu arbeiten, mir grösstmögliche Mühe zu geben und nicht zu ruhen, prägt heute mein ganzes Leben.
Heute reisen Sie als Referent und Experte für Disziplin und Willenskraft um den Globus. Halten Sie Selbstdisziplin wirklich für die wichtigste Tugend des Menschen?
Das klingt etwas antiquiert, nicht wahr? Ich meine mit Disziplin auch nicht diese rigide preussische Strenge, die einem von aussen auferlegt wird. Mir geht es um die Frage, wie Menschen ihren Kampf gegen Selbstbetrug, Versagensängste, Lethargie und Faulheit gewinnen und durch Ausdauer zu Erfolg und Lebensfreude finden können. Das gelingt nur mit stark ausgeprägter Willenskraft.
Wie schult man die Willenskraft?
Die Shaolin-Mönche tun dies in einer Kombination aus körperlicher Aktivität und Meditation. Das ist allerdings sehr anspruchsvoll und verlangt viele Opfer. Weil wir nicht alle Mönche werden können, versuche ich den Wissenstransfer zwischen fernöstlicher Tradition und westlicher Kultur zu fördern. Ich sensibilisiere die Menschen für einige Schlüsselthemen. So halte ich es beispielsweise für sehr gefährlich, sich bei wichtigen Vorhaben auf die eigene Motivation zu stützen. Die Motivation ist keine verlässliche Grösse, sondern eine launische Diva. Die Willenskraft dagegen funktioniert wie ein Muskel. Je regelmässiger wir sie trainieren, desto stärker wird sie.
Welche alltagstauglichen Übungen empfehlen Sie?
Die wichtigste Regel lautet: Hör auf zu jammern. Wer jammert, reduziert seinen Wirkungsgrad um 20 Prozent, wer im Verbund jammert, zieht alle mit herunter. Ich stelle immer wieder fest, dass das Jammern und Lästern hier einem natürlichen Bedürfnis entspricht. Es lohnt sich sehr, sich das abzugewöhnen. Besser ist es, in seinem Umfeld über die nächsten Vorhaben zu reden. Wer sich zu ambitionierten Zielen bekennt und sich ein wenig aus dem Fenster hinauslehnt, gibt seinen Vorhaben eine höhere Verbindlichkeit.
«Der stete Tropfen höhlt den Stein» lautet eine weitere Willenskraftübung. Wie wichtig sind Rituale für Sie?
Rituale geben uns Halt und Struktur. Was wir uns über längere Zeit angewöhnen, kostet uns eines Tages keine Kraft mehr. Ich beginne jeden Tag mit einem 3-minütigen Atemritual aus der Shaolin-Tradition. Mit Atemübungen aktiviere ich meinen Körper, dazu visualisiere ich meine Ziele für den Tag. Danach bin ich hellwach, entspannt und fokussiert. Vor dem Einschlafen fahre ich mein System mit einem anderen Ritual wieder runter. Ich rekapituliere den Tag, bin dankbar für das Geglückte und schaue, wo ich Dinge anpassen muss. Wichtige Pendenzen schreibe ich nieder, um alles loslassen und tief abtauchen zu können.
Das leuchtet ja alles ein. Aber wird man nicht zum Gefangenen im eigenen Haus, wenn alles ritualisiert und durchstrukturiert ist? Wo bleibt da der Freiraum für Spontaneität und Genuss?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind keine Maschinen, die einwandfrei nach Programm ablaufen, sobald alles richtig programmiert ist. Wenn alles verplant ist, ersticken wir im Korsett oder brechen aus. Ich empfehle, ein paar heilige Regeln als Grundpfeiler im Leben zu verankern und daneben viel Freiraum zu lassen. Wäre ich nicht offen geblieben für Unvorhergesehenes, hätten wir dieses Interview nicht führen können. Im bekannten japanischen Management-Ansatz Kaizen werden Tage vereinbart, an denen alle Regeln gebrochen werden dürfen. Dieses Ausbrechen und Rebellieren ist wichtig.
Eine Ihrer Übungen heisst «Wu Wei – Handeln durch Nicht-Handeln». Das klingt machbar.
(Lacht) Verstehen Sie das bitte nicht als Lob der Faulheit. Das nimmt Bezug auf eine taoistische Kriegslist und die Regel: Erkenne die Gesetzmässigkeit des Systems und nutze dies unter Verwendung minimaler Energie zu deinem Vorteil. Ein Meister 9. Grades führte uns Schülern einmal vor, wie er mit blossen Füssen eine schwere Eichentür durchtreten kann. Lächelnd trat er danach wieder in den Raum und sagte uns: «Ja, so stark bin ich. Aber wüsste ich um die Mechanik einer Türklinke, könnte ich mein Ziel sehr viel leichter und ohne Kollateralschäden erreichen.» Ich sehe in meinem Umfeld viele Menschen, die zum falschen Zeitpunkt enorm viel Energie aufwenden, um gegen eine Wand zu rennen.
Sie haben als «blonder Shaolin» einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Wie gefällt es eigentlich Ihren Lehrmeistern, dass Sie das Erlernte in Light-Version unter die Leute bringen?
Da sprechen Sie ein Dilemma an, in dem ich tatsächlich stecke. Die Shaolin-Meister erwarten von ihren Schülern, ihr Ego ganz aufzugeben und sich selber nicht mehr wichtig zu nehmen. Ich schaffe das nur bedingt. Als westlich geprägter Mensch möchte ich nicht nur gut sein, sondern auch gesehen werden, Anerkennung erhalten, etwas bewegen. Als ich meinem Meister von meinen Plänen erzählte, ein Buch über die Shaolin-Tradition und die Schulung der Willenskraft zu schreiben, verzog er sein Gesicht uns sagte: «Es gibt keine Abkürzung auf dem Weg zur Meisterschaft. Man kann nur selber den Weg gehen und es herausfinden. Betrüge niemanden um diese Erfahrung!» Ich schrieb das Buch dann trotzdem, weil ich dieses Wissen vermitteln und es damit einigen Menschen erleichtern will, gelassen, fokussiert und zuversichtlich durchs Leben zu gehen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, auch nach all den Jahren in Asien ist das so. Als mich mein Meister einmal ermahnte, das Gras wachse nicht schneller, wenn man daran ziehe, entgegnete ich sofort, man könnte es doch wenigstens ein bisschen düngen. Der Meister wandte sich von mir ab und ging wortlos aus dem Raum. Aber ich bilde mir ein, dass sein Ohr leicht gezuckt hat. Ich vermute, er hat ein wenig gelächelt.
12. Januar 2016