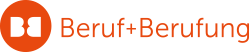Martin Cordsmeier, Gründer und Leiter der Stiftung millionways

«Als würden sich Kühe freiwillig für Betonböden entscheiden»
Menschen fahren am Morgen in Büros, mühen sich dort ab und kehren am Abend erschöpft nach Hause zurück. So sah Martin Cordsmeier als Kind die Arbeitswelt. Ihm war klar, dass er damit nichts zu tun haben wollte. Auf der Suche nach Alternativen entwickelte der Hamburger das Projekt «Millionways»: Menschen sollen sich nicht in Jobprofile einpassen, sondern gemäss ihren Talenten vernetzen.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: ZVG
Kontakt und weitere Informationen:
www.millionways.org oder Tel. 0049 (0)40 20 93 222 0
Herr Cordsmeier, wenn man Ihre Biografie studiert, hat man das Gefühl, Sie hätten sich gar nie für einen Beruf entschieden. Trifft das zu?
MARTIN CORDSMEIER: Ja, das hat was. Mir war das immer unverständlich, wie Menschen Tag für Tag in ein Büro fahren und sich dort ärgern. Meine Eltern haben beide als Beamte gearbeitet, ich verstand als Kind nicht, was sie bei der Arbeit machen. Spürbar war allerdings die Beklemmung, die von dieser Tätigkeit ausging. Ich fragte mich, warum sich die Menschen eine Gesellschaft gebaut haben, die ihnen nicht entspricht, die so wenig menschlich ist. Am Morgen in triste Büros fahren, abends wieder zurück. Das ist, als würden sich Kühe freiwillig für Betonböden entscheiden. Kühe leben aber auf saftigen Wiesen – ich fand, die hatten es besser als die Menschen in ihren Büros.
Ihr wichtigster Vorsatz war also, nie so ein Büro zu betreten?
So konkret war das nicht, ich hatte einfach dieses Fremdheitsgefühl, vielleicht hat es damit zu tun, dass ich adoptiert bin. Jedenfalls fühlte ich mich ein wenig wie ein Alien, in einer mir unverständlichen Welt. Soweit ich zurückdenken kann, hat mich immer nur Journalismus interessiert. Schon als Kind produzierte ich wöchentlich eine Zeitung – ich hatte viel Freude daran und sehr wenig Publikum.
Wie haben Sie später Ihren Lebensunterhalt verdient?
Weil ich nicht in ein Unternehmen wollte, begann ich mit Heimarbeit. Das war in meinen Augen eine wunderbare Alternative – mit netten Menschen zusammensitzen, Tee trinken, diskutieren und nebenher Kartons falten oder andere Dinge erledigen. Meine Freundin und ich waren ein gutes Team. Sie holte mit viel Charme die Aufträge herein, ich richtete eine Website ein und eine kostenlose Telefonnummer, die täglich 24 Stunden in Betrieb war. Rasch erhielten wir sehr viele Aufträge, vor allem von Druckereien, und konnten zusätzliche Leute beschäftigen, Alleinerziehende, Kranke, Obdachlose. Alle verdienten sie bei uns rund 10 Euro pro Stunde, was ganz gut ist für einen Nebenjob.
So wurden Sie zum Unternehmer?
Das war nie mein Ziel, aber ich wuchs da hinein, ja. Mein Hauptanliegen war immer, mit anderen Menschen zu reden, ihre Geschichten und ihre Beweggründe zu verstehen. Oft waren es Bedürftige und Randständige, die mir beim Arbeiten erzählten, wie sie aus dem System gefallen waren: Prostituierte, Obdachlose, psychisch Kranke und Menschen, welche die meiste Zeit im Gefängnis gelebt hatten. Ich verstand nicht, warum ihre Begabungen in der Arbeitswelt nicht gefragt waren; und warum das Heimarbeitgeschäft, das sie mit mir betrieben, immer besser lief. 2006 gewannen wir einen grossen Elektronikkonzern als Kunden. Ich erinnere mich noch gut, wie ich im T-Shirt beim Manager sass, der das Logistikgeschäft für ganz Europa unter sich hatte, und mich wunderte, wie weit ich mit meiner Naivität gekommen war.
Machten Sie das alles weiterhin von zu Hause aus?
Nein, wir hatten inzwischen Lagerhallen in Hamburg und Bayern und 25 Mitarbeiter. Im Jahr 2007 verdienten wir eine schöne sechsstellige Summe. Dann kam der Einbruch 2008, die Unternehmen sparten und vergaben keine externen Aufträge mehr, wir sassen auf unserer Ware und auf Rechnungen, die nicht beglichen wurden. In kurzer Zeit flog mir mein Projekt um die Ohren, ich hatte plötzlich einen Haufen Schulden und lebte von 50 Euro im Monat, alles inklusive.
Wie haben Sie sich aufgefangen?
Das Schlimmste war, dass durch mein Scheitern andere ihren Job verloren hatten, den sie so dringend gebraucht hätten. Ich hatte das Gefühl, diese Menschen im Stich gelassen, mein Wort gebrochen zu haben. Und natürlich war es eine brutale Bauchlandung auch für mich, von der Euphorie direkt in die totale Niedergeschlagenheit. Ein paar Wochen lang war ich sehr apathisch, dann versuchte ich, mich aufzurappeln und aus den Fehlern zu lernen. In dieser Zeit tauchte erstmals der Begriff «Millionways» in meinem Kopf auf und mit ihm die Idee, dafür zu sorgen, dass Menschen gemäss ihren Talenten arbeiten können. Das ist der Vorteil an Krisen: Man hat viel Zeit zum Nachdenken und Träumen.
Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt verdient?
Mit neuen Heimarbeitaufträgen. 2009 probierte ich dann die Zeitarbeit bei einem Personalvermittler aus. Kurz gesagt: Es war schlimmer als befürchtet. Bei jedem Vorstellungsgespräch musste ich eine Kunstfigur spielen. Es ist doch absurd, wenn man in Bewerbungstrainings lernt, sich zu verleugnen und fremden Erwartungen zu entsprechen! Ehrlicherweise müsste man es nicht Vorstellungsgespräch nennen, sondern Verstellungsgespräch. Die Erfahrungen in der Temporärbranche bestärkten mich darin, das Projekt «Millionways» voranzutreiben. Ich wollte eine neutrale Organisation schaffen, die sehr viele Menschen vorurteilsfrei kennen lernt und dann jene miteinander vernetzt, die gemeinsam ein Projekt realisieren können.
Woher hatten Sie das Geld, um eine Stiftung und eine AG zu gründen?
Ich hatte schon in jungen Jahren Frank Otto kennen gelernt, den zweitältesten Sohn von Werner Otto, dem Gründer des Otto-Versands. Frank Otto hatte selber verschiedenste Ausbildungen und Berufe durchlaufen und war sofort Feuer und Flamme für meine Idee. Dank seiner Unterstützung wurde aus der Idee ein Projekt und dann ein Unternehmen. Die gemeinnützige Stiftung Millionways führt Interviews mit Menschen, ergründet ihre Leidenschaften und Fähigkeiten und vernetzt sie so gut wie möglich. Manch ein Künstler könnte gut von seinem Beruf leben, wenn er einen Betriebswirtschafter zur Seite hätte. Und manch ein Betriebswirtschafter würde gerne etwas anderes machen als ein Rädchen im Getriebe eines Konzerns sein, dessen Werte und Ziele er nicht kennt.
Wozu die Aktiengesellschaft?
Wenn durch die Vernetzung von Menschen Projekte entstehen und daraus Unternehmen, kann sich die Aktiengesellschaft Millionways beteiligen und mithelfen, dass die Ideen Hand und Fuss bekommen – nicht nur durch Geld, sondern auch durch Vermittlung eines starken Vertriebspartners. Die AG gehört zu 100 Prozent der Stiftung, alle Gewinne werden zur Finanzierung weiterer Interviews oder sozialer Projekte verwendet. Das Hauptziel ist, die Menschen zu inspirieren und zu ermutigen. Es kann ja nicht das Ziel sein, dass wir alle mit besonderen Gaben, Talenten und Leidenschaften zur Welt kommen und uns im Verlauf des Lebens so stark anpassen, dass wir zwar nirgends mehr anecken, aber auch nichts Persönliches in die Welt bringen.
Wie funktioniert die Vernetzung von Menschen konkret?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Eine Frau, die ihren Job in der Gepäckabfertigung bei einer Fluggesellschaft verloren hatte, träumte davon, eine spezielle Kindertagesbetreuung zu entwickeln. Sie investierte zwei Jahre lang viel Zeit und Herzblut in ihr Projekt, aber da sie keine Ahnung von Businessplänen hatte, wirkte das Ganze auf Nichteingeweihte wenig professionell. Wir waren beeindruckt vom Engagement und der Leidenschaft dieser Frau und vernetzten sie deshalb mit einem Designer und einem Betriebswirtschafter, die beide eine Affinität zum Thema hatten. Das Dreierteam ist nun daran, das Projekt zu realisieren. Es ist gut möglich, dass sich Millionways später finanziell beteiligt.
Was unterscheidet Sie von einer Personalvermittlung?
Wir vermitteln niemanden an ein Unternehmen, sondern wir bringen Menschen zusammen, die gemeinsam etwas realisieren wollen und deren Fähigkeiten sich gut ergänzen. Dafür brauchen wir erstens ein grosses Netzwerk und müssen zweitens die Kompetenzen und Interessen aller Netzwerkmitglieder genau kennen. Wir führen derzeit 70 bis 120 Interviews pro Woche. Obwohl wir bis jetzt kaum in der Öffentlichkeit präsent waren, ist die Nachfrage immens – offensichtlich sehnen sich viele Menschen danach, etwas Sinnvolles und Persönliches tun zu können, statt sich irgendwo in ein Jobprofil zu zwängen. Durch unsere Vernetzungsarbeit sind in den letzten Monaten rund 30 Projekte entstanden.
Wie führen Sie die Interviews?
Natürlich erfassen auch wir, was jemand beruflich schon gemacht hat und offensichtlich kann. Darüber hinaus erfragen wir aber gezielt auch die Eigenschaften, Träume und Ziele der Interviewpartner. So werden viele Substantive und Adjektive erfasst, und wir können anhand von Schlagworten einen ersten Abgleich machen, wenn wir jemanden suchen für ein Projekt. Die Endauswahl geschieht immer individuell, nie automatisch. Oft ist es wichtig, im Interview sehr hartnäckig nachzufragen, was jemanden wirklich bewegt, weil sich viele nicht trauen, über ihr Fachgebiet hinauszudenken.
Woran denken Sie konkret?
Als wir einen Steuerberater nach seinen Talenten fragten, kamen erst wenig überraschende Antworten wie «Bilanzen schreiben» oder «Zahlen interpretieren». Nach längerem Nachfragen erinnerte sich der scheinbar nüchterne Finanzprofi, wie er als Kind mit dem Mähdrescher durch ein Feld gefahren war. Es stellte sich heraus, dass er in der freien Natur jedes Mal aufblühte – etwa wenn er in der Freizeit mit der Fotokamera unterwegs war. Unsere Frage, ob wir ihn ansprechen dürften für ein Fotoprojekt, wiegelte er sofort ab: Er sei ein Anfänger, die Ausrüstung amateurhaft, er habe keine Ausbildung. Wir erfassten seine Passion trotzdem im System. Und als einige Zeit später ein Elektronikkonzern eines seiner Fotos für die Illustration einer Werbekampagne auswählte und ihm dafür 20'000 Euro Honorar zahlte, war das für den Steuerberater ein Schlüsselmoment. Es signalisierte ihm, dass er nicht festgelegt war auf den einst eingeschlagenen Berufsweg.
Eine schöne Geschichte – aber vermutlich doch ein Einzelfall.
Genau dafür setzen mein Team und ich uns mit ganzer Kraft ein: dass dies kein Einzelfall bleibt, dass Menschen vermehrt dem folgen können, was sie bewegt, und damit auch Geld verdienen. Das mag naiv oder weltfremd wirken, aber wer sagt denn, dass die Arbeitswelt so organisiert sein muss, dass wir 40 Jahre lang darauf reduziert werden, was wir in formalen Ausbildungen gelernt und schon anderswo angewendet haben? Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns in so engen Strukturen bewegen; sie erzeugen Angst und Druck und hemmen Inspiration und Innovation.
Was meinen Sie mit engen Strukturen?
Damit meine ich zum Beispiel, dass die meisten Unternehmen Quereinsteigern keine Chance geben. Und dass sie alles schubladisieren. Warum soll nicht ein 9-Jähriger eine bahnbrechende Idee haben? Oder ein 90-Jähriger? Oder ein Autist? Wir haben einen 9-Jährigen mit einer sehr interessanten Geschäftsidee mit einem Betriebswirtschafter vernetzt, der einen guten Draht zu Kindern hat und den entsprechenden Markt kennt. Ich bin überzeugt, dass dadurch einer Idee, die sonst niemand ernst genommen hätte, zum Durchbruch verholfen wird. Leider kann ich noch keine Details nennen, die Sache ist noch vertraulich. Oder das Projekt eines Autisten, der sich ein Computerspiel ausgedacht hat, aber für die Entwicklung Leute braucht, die planen und strukturieren können. Oder im Bereich Senioren: Wir haben die Bewohner eines Altenheims in Hamburg, die gern etwas Sinnvolles machen würden, mit einem Kreativen zusammengebracht. Sie stellen nun unter dem Label «Senior Made» Spielzeuge für ältere Leute her – wir suchen gerade noch einen starken Vertriebspartner dafür. Es gibt so viele Möglichkeiten.
In der Schule lernen wir aber weiterhin: Man sollte überall gute Noten haben und dann eine sichere Stelle finden.
Genau – mit dem Effekt, dass jene, die keine guten Noten nach Hause bringen und keine weiterführenden Schulen besuchen, das Gefühl haben, der Zug sei für sie abgefahren. Deswegen engagieren wir uns im Projekt Teach First Deutschland, das Hauptschüler in Kontakt bringt mit Berufsleuten aus verschiedensten Feldern. Einer unserer Botschafter ist Peter Maffay, der von sich selber sagt: Auch ein Rumäne ohne Deutschkenntnisse kann es schaffen, wenn er seinen Weg geht. Es ist eindrücklich, wie aufmerksam Jugendliche zuhören, die sonst alles verweigern und sich mit Gewalt Luft verschaffen, wenn sie von Vorbildern lernen und selber zu Botschaftern werden können.
Welche Ziele verfolgen Sie mittelfristig mit Millionways?
Wir wollen ein Netzwerk schaffen, in dem es wirklich in erster Linie um den Menschen geht. Das klingt pathetisch, aber das gibt es noch nicht. Es geht uns darum, Projekte zu entwickeln, die nicht vom Profitstreben angetrieben sind, sondern von den Bedürfnissen der Gesellschaft und der einzelnen Individuen ausgehen. Wir wollen nicht mit Dogmatismus die heutige Arbeitswelt bekämpfen, sondern sie verändern, indem wir zu einem Umdenken in der Gesellschaft und der Bildung beitragen. Das übergeordnete Ziel ist, dass sich Menschen nicht bei der Arbeit quälen müssen, damit Unternehmen ihren Profit maximieren, sondern dass sie ihre Talente in den Dienst einer grösseren Sache stellen und damit Geld verdienen können.
3. und 10. Januar 2015