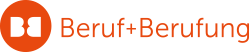Martin Laciga, frühere Weltnummer 1 im Beachvolleyball

«Jeder Bürotag fühlt sich an wie eine Niederlage»
Als Beachvolleyball-Profi war Martin Laciga die Nummer 1 der Welt und ein Star. Nach dem Rücktritt kam er sich vor wie ein 16-Jähriger, der seinen Platz sucht. «Am Anfang wollten viele etwas von mir, aber ich hatte kein Gefühl dafür, was zu mir passte», sagt der 44-Jährige. Nun will er sich mehr von der Freude als vom Erfolgsdruck leiten lassen.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: zvg
Herr Laciga, vor 20 Jahren waren Sie die Weltnummer 1 im Beachvolleyball. Woran erinnern Sie sich noch aus dieser Zeit?
MARTIN LACIGA: 1999 war ein sehr spezielles Jahr für mich und meinen Bruder Paul. Wir verteidigten unseren Europameister-Titel, wurden Vize-Weltmeister, führten die Weltrangliste an. Und wir spürten: Weiter nach oben geht es nicht mehr, ausser wir werden Olympiasieger. Es war aber auch das Jahr, in dem der Erfolgsdruck mir mehr und mehr zu schaffen machte.
Wann hatten Sie sich entschieden, Beachvolleyball-Profi zu werden?
Das war kein bewusster Entscheid, es hat sich so ergeben. Mein Vater war Volleyball-Spieler und wurde später Trainer, meine Mutter war Sportlehrerin – Sport hatte in der Familie einen hohen Stellenwert und es war wichtig, erfolgreich zu sein mit dem, was man tat. Mein Bruder und ich spielten beide Tennis, aber da sich die Familie keinen Trainer leisten konnte, blieb das ein Hobby. Im Beach-Volleyball dagegen schafften wir es rasch an die nationale Spitze, und so entschieden wir uns, nach dem Gymnasium ein Zwischenjahr einzuschalten und nach einem intensiven Trainingsblock unser Glück an Turnieren in Kalifornien und Brasilien zu versuchen. Mir ging es primär ums Reisen und um den Spass, aber wir waren so erfolgreich, dass aus dem Abenteuer ein ernsthafter Beruf wurde.
Was hat sich dadurch verändert?
Mit der Zeit ist die Freude auf der Strecke geblieben. Oder sie wurde überlagert durch den Erfolgsdruck, die Angst vor dem Versagen, die Konflikte. Ich erinnere mich noch gut an unseren ersten Turniersieg auf der World Tour, 1998 im Argentinischen Mar del Plata. Ich fühlte mich dort von Anfang an wohl, wir spielten direkt am Meer, das Stadion war voll, die Stimmung sehr emotional, es gab gute Musik und viele Schweizer Fans – genau wegen dieser Dinge liebte ich Beachvolleyball. Wir feierten den Sieg mit Freunden und anderen Spielern bis zum Sonnenaufgang in einem Party-Club am Meer. Ich tanzte so lange, bis ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen: Sollte ich je ein Turnier gewinnen, will ich ein Jahr lang an diesem Ort bleiben und dieses Lebensgefühl auskosten. Als es soweit war, trieb uns aber der Ehrgeiz weiter, wir strebten sofort nach dem nächsten Erfolg.
Wenn man Sie spielen sah, merkte man nicht viel von dieser Emotionalität.
Ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch und ich mag das Spielerische: Im Training experimentierte ich immer mit unkonventionellen Schlägen, suchte das Tempo, den Überraschungseffekt. Aber je erfolgreicher wir wurden, desto mehr fühlte ich mich unter Druck. Wir gehörten zu den Weltbesten, aber ich gewann in 20 Jahren nur sechs von 206 Turnieren der höchsten Kategorie. Wir hatten also fast immer eine Niederlage zu verdauen, und selbst wenn wir gewannen, fanden wir viele Dinge, die wir hätten besser machen können. Dieser Ehrgeiz, noch besser zu werden, verdrängte die Zufriedenheit über das Erreichte und brachte uns um den Genuss der Erfolge. Dazu kam, dass mein Bruder und ich sehr unterschiedlich tickten. Am Anfang führte das zu gegenseitigen Beschuldigungen und hässlichem Streit, dann schlossen wir eine Art Waffenstillstand und sprachen nur noch über Organisatorisches. Alles Persönliche, alles Emotionale, alles, was zu Konflikten hätte führen können, verdrängten wir. So perfektionierte ich mein Wettkampfgesicht, ordnete alles dem Erfolg unter und wurde mir dadurch selber fremd.
Vor sechs Jahren sind Sie nach 20-jähriger Karriere vom Spitzensport zurückgetreten. Wie ist es Ihnen bei der Neuorientierung ergangen?
Ich hatte grossen Respekt vor diesem Übergang und fühlte mich mit 38 Jahren wie ein 16-Jähriger, der seinen Platz finden muss. In den letzten Spitzensportjahren hatte ich eine dreijährige Marketing-Manager-Ausbildung absolviert, aber dieses Fachwissen gab mir keine Antwort auf die Frage, wer ich bin und was ich künftig tun will. Ich übernahm dann die Leitung eines Hotels in Grächen, das im Familienbesitz war, aber wenn mich die Medien als Hotelier bezeichneten oder Kunden etwas kritisierten, merkte ich, wie wenig ich mich mit dieser Aufgabe identifizierte und wie fragil mein Selbstwertgefühl war. Dann übernahm ich eine Trainer-Aufgabe, coachte ein Österreichisches Beachvolleyball-Duo, zwei Schwestern, die mit ähnlichen Problemen kämpften wie wir damals. Ich merkte aber bald, dass es mir nicht gut tat, mich nochmals diesem Erfolgsdruck auszusetzen und selber auf dem Feld nichts beitragen zu können.
Wenn der Erfolg eine Droge war, ist man als zurückgetretener Spitzensportler permanent auf Entzug.
Ja, das ist ein Teil des Problems, tendenziell fühlt sich jeder Bürotag wie eine Niederlage an. Bei einem Sportler wird das Leben auf den Kopf gestellt. Andere machen eine Ausbildung, steigen beruflich auf, mit 40 oder 50 Jahren erreichen sie den Zenit. Wir erreichten den Höhepunkt mit 25 Jahren und wissen seit dem Rücktritt: Diese Intensität werden wir nie mehr erleben – diese Emotionen, diesen Support der Fans, diesen Triumph. Das wegzustecken, wieder Anfänger zu werden, sich mit kleinen Schritten zufrieden zu geben, ist schwierig. Zudem fühle ich mich unter Beobachtung, auch als Anfänger in einem neuen Bereich. Ich setze mich unter Druck, rasch erfolgreich zu sein, auf keinen Fall etwas in den Sand zu setzen.
Sie empfinden die Bekanntheit mehr als Hypothek denn als Kapital?
Das Positive ist, dass sich die eine oder andere Türe öffnet dadurch. Das Schwierige ist: Man muss unterscheiden lernen zwischen der Figur, die man war, und dem, was einen heute weiterbringt. Am Anfang war es so, dass viele etwas von mir wollten, ich aber kein Gefühl dafür hatte, wer ich war und was zu mir passte. Ich hatte gelernt, durch harte Arbeit erfolgreich zu sein und dank des Erfolgs intensive Emotionen zu erleben. Aber in vielem war ich fremdbestimmt gewesen. Der Wettkampf, das Training, die Ernährung – alles war vorgegeben. Am Schlimmsten fühlte ich mich im November und Dezember, wenn keine Turniere anstanden und wir hätten runterfahren sollen. Da litt ich unter innerer Unruhe, merkte, dass ich ein Getriebener war. Und so war es auch bei den ersten Projekten, die ich nach dem Rücktritt in Angriff nahm: Ich kniete mich in die Arbeit, wollte der sein, der Entscheidendes bewirkt, zog mich rasch zurück, wenn das nicht gelang. Das Wichtigste ist deshalb, mir zu erlauben, etwas primär für mich zu tun. Die Freude wiederzuentdecken, herauszufinden, was sich gut anfühlt unabhängig vom Erfolg.
Haben Sie Ideen, was das sein könnte?
Wichtig war für mich in den letzten Jahren das Tennis. Auf dem Platz entdeckte ich wieder die Spielfreude von einst, und ich genoss es, nicht nur für mich, sondern für ein Interclub-Team zu spielen. Auch Volleyball spiele ich immer noch gerne, solange es nicht zu verbissen zu und her geht. Nun bin ich in ein Projekt in Ins involviert, mit dem wir Strandgefühle ins Berner Seeland holen. Vor zwei Wochen haben wir ein neues Zentrum für Beachsport eröffnet, wo Amateursportler und Profis trainieren, Partys feiern oder sich beim Wellness entspannen können. Ich werde dort Kurse in Beachtennis anbieten, einer neuen Sportart, die leicht zu erlernen ist und beispielsweise in Italien bereits dem Beachvolleyball den Rang abgelaufen hat. Daneben kann ich mir gut vorstellen, vermehrt mit Jugendlichen zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ohne dass die Freude auf der Strecke bleibt. Und im Herbst möchte ich die Ausbildung zum Physiotherapeuten in Angriff nehmen.
2. Februar 2019