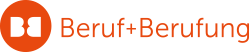Mirko Buri, Koch und Betreiber des ersten Food-Waste-Restaurants

«Ich hoffe, dass ich bald überall Konkurrenz bekomme»
Mirko Burri kochte im Gstaad Palace und in Honolulu, doch kurz vor seinem 30. Geburtstag und der Geburt seines Sohnes verabschiedete er sich aus der Spitzengastronomie. Seither setzt er sich konsequent gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Im Bernischen Köniz betreibt er mit Erfolg ein No-Food-Waste-Restaurant.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: Franziska Rothenbühler
Kontakt und weitere Informationen:
www.mein-kuechenchef.ch oder info@mein-kuechenchef.ch
Herr Buri, warum haben Sie mit knapp 30 Jahren Ihre Ambitionen als Spitzenkoch in der Gourmetküche aufgegeben?
MIRKO BURI: Zu Beginn der Karriere ist es das Grösste, sich in Wettbewerben mit anderen zu messen und Auszeichnungen zu gewinnen. Ich war im Gstaad Palace tätig, als Teil einer 46-köpfigen Küchenbrigade, danach in Honolulu, im Landhaus Bern-Liebefeld und schliesslich im Vier-Sterne-Haus Stella in Interlaken. Es waren lehrreiche, intensive Jahre, aber ich sah auch die Schattenseiten. Ich kannte zum Beispiel fast keinen Küchenchef in der Spitzengastronomie, der ein intaktes Familienleben führte. Die Arbeitstage begannen um 8 Uhr und endeten oft erst nach Mitternacht. Das alles gab mir zu denken, und dann sah ich eines Tages diesen Dokumentarfilm «Taste the Waste» über die gigantische Verschwendung von Lebensmitteln.
Als Gourmetkoch dürften Sie die Problematik gekannt haben.
Klar, wir wussten, dass ein Drittel der Essen, die wir kochten, im Abfall landete, aber das beschäftigte uns nicht weiter, der Kunde hatte das ja bezahlt. Und natürlich hatte ich ein paar Mal leer geschluckt, wenn ich nach einem Kochwettbewerb an den Containern vorbeiging, in denen unsere Patisserie-Kunstwerke entsorgt wurden – manchmal sah ich sogar, wie Mannschaften aus anderen Ländern unsere Friandise wie Gold-Nuggets herausfischten. Aber die ganze Dimension wurde mir erst durch den Film bewusst. Danach fand ich es absurd, diesen Food-Porn, den wir da veranstalteten, diese Diskussionen über 2 Millimeter zu klein geschnittenen Lachs oder nicht perfekt abgerundete Kartoffelkanten. Ich kochte ein letztes grosses Bankettdiner im Stella, es wurde ein unvergesslicher Abend, auch dank dem Mitwirken meines Onkels, der dem Abend als Maler und Bildhauer eine künstlerische Note gab. Mein Onkel starb kurz danach, und ich spürte: Besser geht es nicht mehr, es ist an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
Das sagt sich leicht, aber wie macht man das, wenn man mit den Spielregeln der eigenen Zunft bricht?
Nach diesem Doku-Film hatte ich das Gefühl: Es läuft so ziemlich alles schief in unserer Welt. Es reicht definitiv nicht mehr, mit dem Velo statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und ansonsten weiterzumachen wie bisher. Zum Glück hatte ich schon im zweiten Lehrjahr angefangen, etwas Geld beiseite zu legen und eine eigene Kochschule aufzubauen. Was mit Kursen für den Frauenverein und die Feuerwehr begann, zog über die Jahre immer weitere Kreise. Als ich mit knapp 30 aus der Gourmetküche ausschied und Vater wurde, übernahm ich das Kochen für die eigene Familie. Ich wusste, dass die Privathaushalte die grössten Sünder waren bei der Lebensmittelverschwendung, und als Koch hatte ich gelernt, zu kalkulieren und einzukaufen. Ich übertrug das auf unsere Familie, machte Wochenpläne, tätigte Grosseinkäufe und kochte vor für eine Woche. Dann meldeten sich Freunde, die mitkochen wollten, später Freunde von Freunden – bald belieferte ich 70 Haushalte in Bern.
Inwiefern war das ein Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung?
Ein Drittel der in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren oder wird verschwendet. Das sind jährlich 300 Kilo pro Person oder 2,3 Millionen Tonnen total, sprich eine durchgehende Kolonne von 40-Tonnen-Lastwagen von Bern nach Madrid, vorsichtig berechnet. Knapp die Hälfte dieses «Food Waste» verursachen die Privathaushalte, dort sollte man also den Hebel ansetzen. Leider fehlt es komplett am Bewusstsein. 90 Prozent kennen das Problem, aber 95 Prozent denken, die Nachbarn seien die Sünder. Die Leute kaufen nach Lust und Laune ein, weil sie es sich leisten können, auch für die Kinder, die seit Jahren nicht mehr zuhause wohnen, und bei jedem Familien- oder Vereinsfest bleiben Berge von Nahrungsmitteln übrig.
Wie versuchen Sie da Gegensteuer zu geben?
Indem ich überschüssige Lebensmittel zu hochwertigen Produkten verarbeite. Dabei setze ich auf eine spezielle Verarbeitungsmethode. Das Problem der im Kühlschrank gelagerten Frischprodukte ist, dass sie durch den Kontakt mit Sauerstoff in wenigen Tagen verderben. Das kann durch das Sous-Vide-Garen vermieden werden. Ich gare die Lebensmittel im Vakuumbeutel bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad. So bleiben sie danach ohne Konservierungsstoffe während bis zu drei Monaten im Kühlschrank haltbar. Zudem sind vernünftige Portionen abgemessen.
Das betrifft die Speisen, die Sie über ihren Webshop vertreiben. Welche Akzente setzen Sie mit ihrem eigenen Restaurant «Mein Küchenchef» in Köniz?
Hier setzen wir auf einen Mix: Frisch gekochte Tagesmenüs und Sous-Vide vorgekochte A-la-carte-Gerichte. Alles in diesem Restaurant ist darauf ausgerichtet, Verschwendung zu vermeiden. Mit jedem verkauften Menu sparen wir 200 Gramm Lebensmittel ein. Wir verwenden regionale Produkte, die zu klein oder krumm gewachsen sind oder wegen Überproduktion nicht verkauft werden können – pro Jahr rund 20 Tonnen Gemüse aus regionalem biologischem Anbau. Und wir setzen zu mehr als 80 Prozent auf vegetarische Gerichte, weil wir uns bewusst sind, dass es 15’000 Liter Wasser braucht für ein Kilo Rindfleisch. Das normale Mittagsmenu kostet hier 15 Franken und ist vegetarisch, wer Fleisch essen möchte, kann das à la carte bestellen und dafür mehr bezahlen. Das Fleisch stammt in jedem Fall aus Bauernbetrieben aus der Gegend, kein Import, keine Massentierhaltung. Und wir verwenden immer das ganze Tier.
Sie verfolgen also heute pädagogische Ziele als Koch und Unternehmer.
Viele Gäste, die gerne hier essen, sind Fleischesser, die nicht sofort merken, dass sie gerade etwas Vegetarisches oder Veganes essen. Ich bin keiner, der mit erhobenem Zeigefinger die Kunden belehrt, der Genuss muss beim Essen immer im Vordergrund stehen – da habe ich dank meiner Gourmetküchen-Vergangenheit gute Argumente. Wenn Unternehmen bei mir Team-Events in der Küche buchen, komme ich mit Leuten in Kontakt, die sich nie für einen Food-Waste-Kochkurs einschreiben würden. Kürzlich sagte ich einem dieser Manager stolz, ich hätte inzwischen schon sechs Angestellte. Er meinte trocken, er habe 22’000 Leute unter sich. Es ist für mich sehr interessant, bei den Team-Events und bei Weiterbildungs-Veranstaltungen in der Unternehmensgastronomie mit einflussreichen Managern in Kontakt zu kommen. Diese Leute haben die Mittel, Grundlegendes zu verändern.
Sie kochen zwar nicht mehr um Punkte und Sterne, sind aber eine Marke geworden und ein gefragter Berater. Hat Sie der schnelle Erfolg überrascht?
Was ist Erfolg? Erfolgreich wäre ich, wenn ich mehr als homöopathisch gegen die Lebensmittelverschwendung wirken könnte. Dafür bräuchte es nicht ein, sondern hundert Foood-Waste-Restaurants in der Schweiz. Ich hoffe also, dass ich bald überall Konkurrenz bekomme. Erfolg bedeutet für mich auch, dass ich einen Feinkost-Einkäufer beschäftigen kann, der die Bauern in der Region besucht und ihnen faire Preise zahlt für ihre Ware – und dass das Menu dann trotzdem nur 15 Franken kostet; und dass wir das Gebäude mit der Küchenwärme heizen und Solarstrom beziehen. Erfolg ist für mich, dass es mir gelang, eine Gemüsebouillonpaste ohne Palmfett zu entwickeln, die Rüstabfälle für Rüebli- oder Randen-Salz zu verwenden, den Gerichten keine Unmengen von Zucker beizumischen für bessere Haltbarkeit. Meine Mutter hat 10 Kilo abgenommen, seit sie bei mir einkauft und isst, manche Kunden richten mir Grüsse von ihren Zahnärzten aus und die Losinger-Marazzi-Manager haben gemerkt, dass die Mitarbeiter, die bei uns essen, leistungsfähiger sind am Nachmittag, weil wir auf den glykämischen Index achten und so den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle halten.
Der Karriere in der prestigeträchtigen Sterneküche trauen Sie kein bisschen nach?
Nein, ich habe es oft genug erlebt, dass einem dieser Stars mit 55 oder 60 Jahren ein Stern weggenommen wurde, weil ein Jüngerer etwas Aufregenderes zu bieten hatte. Das kann jemanden innerlich brechen, manche Spitzenköche sahen nach so einem Gesichtsverlust keinen anderen Ausweg mehr als den Suizid. Ich bin froh, nicht davon abhängig zu sein, dass jemand mir ein Gütesiegel erteilt, sondern unternehmerische Lösungen suchen zu können für gesellschaftlich relevante Probleme.
Welche Ziele peilen Sie als nächstes an?
Ich lebe extrem im Moment und mache keine grossen Pläne. Ich begann mit 30’000 Franken Erspartem, investierte das Geld in Küchengeräte und Kühlschränke und steckte die Erträge immer in den Betrieb. Das nächste Ziel ist, den Umsatz so weit zu erhöhen, dass ich mir einen Stellvertreter leisten kann. Zum einen ist es mir wichtig, täglich Zeit mit meinem fünfjährigen Sohn zu verbringen, zum anderen bin ich so etwas wie ein Botschafter im Kampf gegen Food-Waste geworden – es gibt kaum mehr eine Woche, in der ich nicht drei Interviews zu diesem Thema gebe. Nun ist es an der Zeit, das Thema etwas grösser zu denken. Nichts gegen unsere Anti-Food-Waste-Bouillon, aber richtig erfolgreich bin ich erst dann, wenn grosse Player wie beispielsweise die Haco oder Unilever ein solches Produkt in ihr Sortiment aufnehmen.
9. September 2017