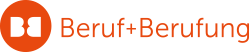Philipp Riederle, Buchautor und Unternehmensberater

Ein 19-Jähriger erklärt die neue Welt
Mit acht Jahren programmierte er die erste Website, mit 13 hackte er das iPhone, mit 15 wurde er Unternehmensberater. In ganz Europa lernen Manager von Philipp Riederle, wie die Generation Y tickt. Der 19-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt: «Wir wollen keinen Chefsessel und keinen fetten Dienstwagen, sondern mit Gleichgesinnten etwas bewegen können.»
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: ZVG
Kontakt und weitere Informationen:
www.riederle.de oder philipp@riederle.de
Das Buch:
Philipp Riederle: Wer wir sind und was wir wollen. Ein Digital Native erklärt seine Generation. Knaur Verlag 2013.
Herr Riederle, früher lief das so bei Akademikern: erst die Matura, dann Studium, Trainee-Programm, erste Stelle, erste Führungserfahrung... Und irgendwann zwischen fünfzig und sechzig der Schritt in die Beratung. Sie sind gerade 19 geworden und europaweit als Referent und Unternehmensberater unterwegs. Wie kam es dazu?
PHILIPP RIEDERLE: Ich habe mich schon als kleines Kind sehr für technische Fragen interessiert. Mein Grossvater war Elektromeister, von ihm lernte ich viel. Ich lötete im Selbstversuch Elektronik-Schaltungen zusammen, manipulierte TV-Geräte und Computer und programmierte als Achtjähriger meine erste Website. Als ich 13 war, wurde das erste iPhone in San Francisco vorgestellt. Ich importierte so ein Wunderding aus den USA und suchte im Internet nach Anleitungen, wie man es hackt. Weil ich nichts Brauchbares fand, machte ich mich selber ans Werk und sorgte dafür, dass es mit dem deutschen Mobilfunknetz funktionierte. Ich dachte, das interessiere vielleicht auch andere Leute, und filmte, wie ich das iPhone hackte. Den Podcast veröffentlichte ich auf meiner Website.
Wie viele Besucher besuchten die Seite?
Vorher war ich jeweils happy, wenn fünf Besucher pro Monat dort etwas über meine Hobbys lesen wollten. Als ich den Blog «Mein iPhone und ich» lancierte, erhöhte sich die Besucherzahl massiv – erst auf 100, bald auf 1000 und 10'000 pro Beitrag. Nach zwei Jahren waren es über 100'000 Leute, die sich das anschauten. Weil der Server diesem Ansturm nicht mehr gewachsen war, gründete ich mit 15 Jahren eine Medienproduktionsfirma und schaltete Werbespots auf der Plattform. Und dann kam der Anruf des Managers einer grossen deutschen Telekom-Unternehmung, der sich fragte, warum ein unbekannter 15-Jähriger 100'000 Leute erreichte und er mit der bekannten Marke so viel Mühe hatte.
Und da begriffen Sie: Ich bin jetzt Berater?
Diese Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich traf mich einfach mit den Managern des Konzerns. Erst redeten wir über Podcasts und andere technische Dinge, bald stand aber die Frage im Mittelpunkt, wie diese Generation Y eigentlich tickt. In den nächsten drei Jahren arbeitete ich mit über 150 Firmen zusammen, vom lokalen KMU bis zu internationalen Konzernen mit mehreren 10'000 Angestellten. Die meisten Unternehmen tun sich schwer, die jungen Leute anzusprechen. 50-jährige Manager haben da viele Vorurteile und Illusionen. Aber sie wissen, dass sie die Jungen erreichen müssen, als Kunden und als künftige Mitarbeiter. Weil sie nicht ihre eigenen Kinder fragen wollen, holen sie mich als Berater ins Haus. (Lacht)
Welche Vorurteile versuchen Sie zu entkräften?
Etwas überspitzt gesagt denken die Manager über uns Junge: «Ihr arbeitet ja gar nicht und habt keine richtigen Freunde. Ihr macht bloss den ganzen Tag an diesen Wischgeräten herum.» Ich verstehe diese Abwehrhaltung, aber sie ist kontraproduktiv. Die Manager, die heute in Machtpositionen sind, stehen unter grossem Druck. Sie müssen mühsam den Gebrauch neuer Technologien lernen, mit denen wir Jungen ganz selbstverständlich aufgewachsen sind. Und sie stellen fest: Status, Seniorität, Funktionen– all das zählt nicht mehr viel in der Generation Y. Wir wollen keinen Chefsessel und keinen fetten Dienstwagen, sondern mit Gleichgesinnten etwas bewegen können.
Inwiefern bedroht das die heutigen Machtträger?
Weil heute die meisten Leute einen unbegrenzten Zugang zum Wissen haben und die jüngeren Leute dieses Wissen tendenziell besser anzuzapfen verstehen, müssen Manager dazu lernen. Seien wir ehrlich: Die jungen Talente, um die sich alle Unternehmen bemühen, nehmen keinen Job mehr an in traditionellen hierarchisch geführten Betrieben. Wenn doch, sind sie nach zwei Jahren wieder weg. Ein Bekannter von mir arbeitete im weltweit grössten Software-Konzern. Er hatte eine hervorragende Business-Idee, aber sein Chef bremste ihn mit dem Argument, das Thema falle gar nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Er kündigte, setzte die Idee mit seinem Startup um – und der Konzern kaufte sich die Idee später für einen höheren Millionenbetrag wieder ein.
Das ist ein spektakulärer Einzelfall.
Nein, ganz und gar nicht. Wie sind die ersten Smart Watches oder Intelligenten Uhren entstanden? Glauben Sie, das waren Konzernmanager, die mit Hilfe von Banken ein Projekt lancierten? Nein, da sassen viele gut vernetzte Hacker in ihren kleinen Buden und begeisterten 70'000 Privatinvestoren für diese Idee, so dass in kurzer Zeit 10 Millionen Euro zusammenkamen, ohne dass einer dieser Freaks einen Anzugträger in einer Bank hätte überzeugen müssen. So funktioniert das heute. Junge Leute hauen eine Idee raus und finden Mitstreiter. Sie leben fürs Arbeiten und haben keine Lust, in ein Unternehmen einzutreten, wo der Dienstweg heilig ist und die Menschen arbeiten, um sich eine teure Freizeit leisten zu können.
Leben fürs Arbeiten? Das klingt nicht sehr verheissungsvoll.
Ich finde, es klingt besser als Work-Life-Balance. Vor 20 Jahren strebten Berufseinsteiger hauptsächlich drei Dinge an: Geld, Status und Macht. Heute geht es uns in erster Linie um Sinnhaftigkeit, Selbstverwirklichung und ein gutes Team.
Welches sind die häufigsten Fehler von Unternehmen beim Versuch, die Generation Y zu erreichen?
Dass sie ein paar Dinge tun, die gerade im Trend sind, und denken, nun seien sie modern. Chefs reden derzeit zum Beispiel gerne über die Gestaltung und den Bezug von modernen Grossraumbüros. Oder sie sind stolz auf den jugendlichen Facebook-Auftritt. Dabei bewegen die besten Büros und Social-Media-Auftritte nichts, wenn sich die Kultur nicht ändert. Entscheidend ist, wie geführt wird und wie die Zusammenarbeit organisiert ist. Das hat viel mit der Frage zu tun, wie Macht und Verantwortung legitimiert werden. Wenn da weiterhin Barrieren in den Köpfen sind, bringt es nichts, die Bürowände einzureissen.
Gäbe es für einen hochbegabten 19-Jährigen nicht interessantere Aufgaben als die des Unternehmensberaters?
Im Moment ist das der schönste Beruf der Welt für mich. Ich kann Verständnis schaffen für meine Generation und für die technologischen Möglichkeiten – nicht nur im Gespräch mit Konzernchefs, sondern auch am Elternabend unserer Schule, an dem ich natürlich ehrenamtlich rede. Ich glaube, ich bin trotz der ungewöhnlichen Karriere ein ganz normaler Teenager geblieben, der hier in einem 8000-Seelen-Ort seine Freunde hat und das Vereinsleben geniesst. Im Sommer habe ich das Abitur gemacht, nun möchte ich bald ein Studium in Angriff nehmen – Kulturgeschichte vielleicht.
Und stimmt es denn, dass die Jungen heute so viel am Bildschirm sitzen, dass sie keine echten Freundschaften mehr pflegen?
Nein, dieses Klischee ist vielfach wiederlegt. Aber natürlich kämpfen wir alle mit der Herausforderung, nicht dauernd auf vielen Kanälen online zu sein. Ich war in den ersten Jahren sehr angefressen, heute nutze ich die Technologie selektiver. Während unseres Gesprächs habe ich kein einziges Mal aufs Smartphone geschaut. Und in der Nacht schalte ich es ganz aus.