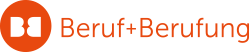Reto Camenisch, Fotograf

«Erwiderte Liebe ist das Schönste»
«Ich habe in Kauf genommen, niemand zu sein für den Markt», sagt der Fotograf Reto Camenisch. Statt weiterhin im Auftragsverhältnis um die Welt zu fliegen, hat er Berge erwandert und in die eigenen Abgründe geschaut. Nun ruft das Himalaja-Gebirge.
Interview: Mathias Morgenthaler Foto: Adrian Moser
Kontakt und weitere Informationen:
www.camenisch.ch
Herr Camenisch, wann haben Sie begriffen, dass die Bilder, die Sie mit Ihrem Fotoapparat machen, Kunst sind?
RETO CAMENISCH: Ich bin in erster Linie Fotograf. Mit dem Begriff «Künstler» habe ich meine liebe Mühe, weil er impliziert, dass alles, was ein Künstler anfasst und herstellt, dadurch zu Kunst wird. Oft glaubt das nicht nur das Publikum, sondern auch der Künstler selber. Ich habe das nie so empfunden.
Sie möchten am liebsten gar nicht von Kunst sprechen?
Doch, aber die Kunst manifestiert sich nicht nur im Werk, sondern auch in einer Lebenshaltung. Der Komponist Arnold Schönberg hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, als er festhielt: «Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen.» Insofern beinhaltet Kunst eine grosse Portion Kompromisslosigkeit – anderen und sich selber gegenüber. Als ich hauptsächlich im Auftrag anderer unterwegs war, floss zwar immer etwas von mir in diese Bilder ein, es handelte sich aber um die Bearbeitung eines mir fremden Grundgedankens.
Der Impuls muss also von innen kommen?
Ja, die Arbeit muss ganz direkt mit mir zu tun haben, es geht um die innere Verbindung zwischen Person und Werk. Hier kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Betrachten wir nur die Werkebene, entsteht manchmal in kurzer Zeit sehr viel. Dem geht aber oft ein sehr langer innerer Prozess voraus. Deswegen ist die Ausrichtung so wichtig. Ich kann nicht dauernd Aufträge ausführen und darauf hoffen, irgendwann in einer Pause von der Muse geküsst zu werden.
Sind die vielen Jahre im Fotojournalismus für Sie verlorene Jahre oder waren sie wichtig für Ihre Entwicklung?
Für mich war es wichtig, mit klaren Grenzen arbeiten zu können. Unsere Gesellschaft ist stolz darauf, dass es fast keine Grenzen mehr gibt, dass alles möglich ist. Ich bin der Überzeugung, dass wir Grenzen brauchen, wenn wir unser schöpferisches Potenzial voll entfalten wollen. Grenzen helfen mir bei der Orientierung, bei der Entwicklung. Aber wenn ich nur noch dazu da bin, die Wünsche anderer zu erfüllen, entferne ich mich von mir selber.
War es ein abrupter Wechsel vom Fotojournalismus zum Fotokünstler oder hat sich das organisch entwickelt?
Es war buchstäblich eine organische Entwicklung: Ich hatte Erfolg, wurde aber krank und kränker. Es klang so toll: der Schweizer Fotoreporter mit seiner Fototasche im Swiss-Flugzeug nach Delhi, nach Hongkong, Auftrag hier, Auftrag dort. Ich dachte, ich sei endlich das geworden, was ich immer sein wollte. Mit der Zeit spürte ich, wie hoch der Preis war. Einmal war ich mit Bänz Friedli im Auftrag von «Facts» unterwegs. Wir sind in sechs Tagen 7000 Kilometer gereist und haben vier Geschichten produziert. So etwas ist absurd. Man hastet durch die Welt, erlebt nichts und tut, als hätte man etwas Wichtiges zu sagen. Wenn ich diese Irrfahrten auf einer Weltkarte nachzeichnen wollte, bräuchte ich unzählige Fähnchen – und doch bin ich nirgends gewesen.
Daran änderten Sie erst etwas, als der Körper streikte?
Ja, da war ich nicht klüger als all alle anderen. Dazu kam aber etwas Zweites: Ich hatte immer den Anspruch, nach der Wahrheit zu suchen, obwohl ich weiss, dass es sie nicht gibt. Wenn ich mich fotografisch auf jemanden einlasse, möchte ich herausfinden, wer er ist. Und gleichzeitig frage ich mich, warum ich diese Person so sehe. Ich muss mir die Zeit geben, meiner Wahrnehmung zu misstrauen. Die Beziehung zwischen dem Fotografen und seinem Objekt muss wachsen können. Wenn man einen Berg fotografiert, macht es einen grossen Unterschied, ob man ihn zu Fuss erklimmt oder ob man sich aus einem Helikopter absetzen lässt. Das musste ich mit viel Aufwand herausfinden, denn ich bin ein unruhiger Mensch, der sich mit Warten schwertut.
Wie sind Sie mit der Fotografie in Berührung gekommen?
Das war im Alter von 15 Jahren. Ein Kollege brachte eine Fotokamera in die Physikstunde und liess mich einen Blick hindurch werfen. Ich sehe heute noch vor mir, was ich damals sah. Da war nur noch die Wandtafel, der Tisch mit den Plastikröhrchen, der Wasseranschluss. So ereignete sich für mich in diesem durch und durch hässlichen Raum etwas Spektakuläres. Ich war komplett fasziniert, wie ich durch die Kamera meine Umgebung auf einen bestimmten Ausschnitt begrenzen konnte. Dann entdeckte ich die vielen Zahlen auf dem Objektiv. Ich konnte nie mit Zahlen umgehen, aber diese Zahlen verstärkten die Anziehungskraft noch. Irgendwie gelang es mir, meinen Schulkameraden dazu zu überreden, dass ich seine Kamera mit nach Hause nehmen durfte.
Es begann mit einer Obsession?
Ja, ich probierte dann tage- und nächtelang aus, was man mit der Kamera anstellen kann. Ich habe nie einen Kurs besucht und nie eine Anleitung gelesen, sondern mir alles, was ich heute weiss, durch Erfahrung angeeignet. Wir lernen am meisten, wenn wir handeln – nicht wenn wir nachlesen und nachdenken. Es gab damals noch ein zweites wichtiges Erlebnis: Ich sah eines Tages das Bild «Juke Joint» von Robert Frank und war komplett erschlagen von dieser Ausdruckskraft. Ich begriff schlagartig, dass ein einziges Bild eine ganze Gefühlswelt eröffnen kann, dass ein Bild mich tragen, mir Geborgenheit geben kann. Das ist noch heute so. Wenn mir etwas Schweres widerfährt, kann ich mich an ein Bild erinnern und mich daran wieder aufrichten.
Sie machen selber Bilder, denen das Etikett «düster» anhaftet.
Was heisst das denn? Er macht düstere, schwere Sachen. Melancholie ist nicht mit Deprimiertheit gleichzusetzen, Schwere ist nicht nur ein Gewicht, sondern bedeutet auch Fundament – man steht schwer auf dem Boden. Solche Themen interessieren mich. Wenn man dem nachsteigt, findet man heraus, wie sehr man fremdbestimmt ist, wie viele Meinungen und Gefühle von anderen wir mit uns herumtragen. Mehr Achtsamkeit in der Wahrnehmung verhilft einem zu mehr Eigenständigkeit. «Etwas für wahr nehmen» – das ist eine aktive, selbstverantwortliche Handlung. Genau und geduldig hinzuschauen, ist deshalb auch ein Akt der Befreiung.
Wie war das, nach all den Jahren als Auftragnehmer plötzlich für sich selber verantwortlich zu sein – eine Befreiung oder eine Qual?
Da war zunächst nur eine grosse Angst, ich war in einem völlig luftleeren Raum. Ich wusste, dass ich mich bremsen musste, mich abwenden musste von allem, was da draussen leuchtet und laut schreit, was den Blick anzieht. Ich begann, die Bergwelt zu erwandern, um meiner Unruhe Herr zu werden. Ich merkte, dass ich täglich den Niesen sah und nicht das Geringste wusste über diesen Berg. Ich hätte viel über ihn erzählen können, aber ich wusste nichts, weil ich bisher nie geduldig und demütig genug gewesen war, mich auf den Niesen einzulassen. Es war für mich sehr wichtig, die gewohnten Denk- und Handlungsraster aufzubrechen. Dazu gehörte auch, dass ich relativ oft nach Tagen in der Natur ohne ein einziges Bild zurückkam. Das Ziel der Wanderungen durfte nicht sein, tolle Bilder zurückzubringen, sondern etwas über mich in Erfahrung zu bringen.
Wie kamen Sie finanziell über die Runden?
Ich verdiente über längere Zeit mein Geld als Car- und Lastwagenchauffeur. Das war eine harte Zeit. Ich war 41 und schämte mich, hätte auf der Raststätte jedem erklären wollen, dass ich eigentlich Fotograf bin, nicht Lastwagenfahrer. Ich war aber überzeugt: Wenn ich mir begegne und meinen Weg gehen kann, dann wird das Fotografieren auch Geld generieren. Aber erklär das mal einer Bank oder einer Kulturförderungsinstitution. Den meisten Leuten sind Personen suspekt, die mit Arbeit kein regelmässiges Einkommen erzielen. Viele empfinden es zudem als Provokation, dass einer sich die Freiheit herausnimmt, einfach das zu tun, was er will. Das Künstlerdasein ist aber weit komplexer.
Inwiefern?
Viele glauben, kreativ zu arbeiten sei gleichbedeutend mit viel Zeit haben und auf Inspiration warten. Künstler seien Chaoten, sagt das Klischee. Meine Arbeit ist insofern chaotisch, als ich auf extrem vielen Kanälen Impulse empfange. All diese Informationen zu ordnen, sie zu kanalisieren, ist eine immense Arbeit. Sie gelingt nur, wenn ich extrem diszipliniert bin. Sonst würde mein System abstürzen.
Was heisst Disziplin für Sie?
Ich arbeite konsequent sechs Tage pro Woche, bin stets zwischen halb neun und neun im Atelier, gehe gegen 17 Uhr nach Hause und arbeite dann noch bis gegen 21 Uhr weiter. Am Sonntag zwinge ich mich, nicht zu arbeiten. Auch die Ernährung und die Jogging-Runden haben direkt mit meiner Arbeit zu tun. Ich mache das nicht, um Augensäcken oder Bauchansatz vorzubeugen, sondern ich muss meinem Körper die Kraft zur Verfügung stellen, die er braucht, um die vielen Sinneseindrücke zu materialisieren. Ohne dieses strikte Gerüst würde ich todsicher abstürzen. Der Künstler ist wie ein Motor, der immer läuft, wie ein Teebeutel, der alles aufsaugt. Wenn er dem Chaos aus Eindrücken keine eigene Ordnung entgegensetzt, ist er verloren.
Gelingt es Ihnen, mit Disziplin die Unruhe in den Griff zu bekommen?
Es bleibt eine Gratwanderung. Vor sieben Monaten habe ich meine Mutter verloren. Den Bildern von meiner toten Mutter auf dem Bett war ich wehrlos ausgesetzt, ich brachte sie nicht mehr aus dem Kopf. Ich sehe noch genau vor mir, wie sich die Haut an ihren Händen veränderte, ihre physische Präsenz langsam verschwand bis zum Tag ihrer Einäscherung. Das macht Angst und braucht unglaublich viel Energie. Wenn ich diese Energie nicht sorgfältig aufbaue, zerreisst es mich. Sich als Mensch auf die Welt einzulassen, braucht viel Kraft und Mut. Diese Arbeit hat nichts zu tun mit dem romantisch-schöngeistigen Künstlerideal.
Ihre Hauptarbeit besteht also darin, sich ganz auf die Welt einzulassen und gleichzeitig all dem Chaotischen, Bedrohlichen ein inneres Ordnungssystem entgegenzusetzen. Welchen Wert hat für Sie das Endprodukt dieses Prozesses, das Bild?
Manchmal werde ich gefragt, ob es mir wehtut, diese Fotografien wegzugeben. Dann muss ich mich beherrschen, nicht laut herauszulachen. Wichtig ist für mich, dass mir diese Begegnung möglich war, dass mir ein Fenster geöffnet worden ist und ich Zugang erhielt zu etwas, das grösser ist als ich, aber doch sehr stark mit mir zu tun hat. Das hat viel mit gutem Timing zu tun. Zum fertigen Bild habe ich keinen Zugang mehr, es interessiert mich kaum.
Immerhin hängt Ihr Einkommen vom Verkauf der Bilder ab.
Natürlich freut es mich, wenn meine Bilder andere Menschen berühren. Kürzlich sagte mir jemand, er habe eines meiner Bilder vor zwei Jahren in einer Ausstellung gesehen und er müsse es jetzt einfach kaufen. Das tut gut, unabhängig davon, was er im Bild sieht. Für mich manifestiert sich darin die Liebe zu diesem Moment. Wenn das Bild einen Betrachter fesselt und er mit Freude einen grösseren Betrag dafür bezahlt, ist das wie erwiderte Liebe. Erwiderte Liebe ist das Schönste, was es gibt. Ich würde das Gleiche machen, wenn sich niemand dafür interessierte, so wie man Menschen liebt, ohne auf Gegenliebe zu hoffen, aber es ist unendlich viel schöner, wenn dir jemand sagt: «Ig ha di gärn.»
Welche Themen beschäftigen Sie?
Ich interessiere mich für Zerfalls-und Erosionsprozesse, die im Gebirge gut zu sehen sind. Wichtig ist mir auch die Nähe zum Himmel. Ich meine das nicht im engeren Sinn religiös, aber der Satz «in den Bergen ist man nah bei Gott» hat für mich eine Bedeutung. Und ich suche Landschaften, in die der Mensch nicht zu sehr eingegriffen hat. Ich zeige nicht mehr den Menschen im Porträt, sondern das Menschsein und Menschwerden in der Landschaftsfotografie.
Wenn Sie den Zerfall und die Höhe ansprechen, denkt man unweigerlich daran, dass Ihr Vater auf der Jagd im Gebirge verunglückt ist, als Sie sechsjährig waren.
Ich musste früh lernen, Abschied zu nehmen: von meinem Vater, von meiner Schwester, kürzlich von meiner Mutter und von weiteren Personen aus meinem engsten Umfeld. Das hat mich geprägt und prägt auch mein Schaffen.
Hat das Aufkommen der digitalen Fotografie Ihre Arbeit verändert?
Nein. Ich fotografiere nach wie vor analog, meistens mit Schwarz-Weiss-Filmen. Die digitale Fotografie hat noch grosse Schwächen in der Vermittlung von Licht. Und: Es macht einen grossen Unterschied, ob ich als Schütze 30 Pfeile oder nur einen einzigen im Köcher habe. Im ersten Fall schiesse ich den ersten los und schaue dann, was passiert. Wenn ich nur einen habe, muss ich tiefer schürfen, dann ist die Bildauslösung nur die letzte Station einer langen Reise.
Wann drücken Sie den Auslöser?
Wenn ich glaube, in Berührung mit einem Material gekommen zu sein. Es ist ein intuitiver Vorgang. Ich muss keine spektakulären Sujets suchen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich über längere Zeit kontrovers zu dem gearbeitet habe, was auf dem Markt verlangt wird. Ich hätte vermutlich keine Geldsorgen gehabt, wenn ich in den letzten zehn Jahren farbig und grossformatig fotografiert hätte. Als Schwarz-Weiss-Fotograf wird man leicht in die Nostalgie-Ecke gestellt. Ich habe es in Kauf genommen, niemand zu sein für den Markt. Das ist immer wieder schmerzhaft, aber für meine Entwicklung war das wichtig. Heute loben mich manche als den Unbeirrbaren, die mich vor zehn Jahren als ewig gestrigen Ignoranten beschimpft haben.
Mit welchen Gefühlen sehen Sie dem Aufbruch in Richtung Himalaja entgegen?
Es ist Zeit, mich etwas Neuem, Fremdem auszusetzen. Gleichzeitig ist es unternehmerisch ein grosses Wagnis: Das Projekt kostet viel Geld. Meine Galeristen werden Ausstellungen in Zürich und in Köln organisieren. Wenn ich dort 2010 nicht einiges verkaufe, habe ich ein grosses Problem. Mit diesem Projekt lehne ich mich so weit zum Fenster hinaus wie noch nie. Das macht mir Angst. Ein- bis zweimal pro Woche erwache ich um 4 Uhr morgens und spüre diese Angst.
Februar 2009