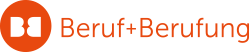Thomas Zurbuchen, Forschungsdirektor der NASA

«In 30 Jahren werden vermutlich Menschen auf dem Mars leben»
Seit Ende September 2016 ist Thomas Zurbuchen der höchste Wissenschaftler der Nasa. Er entscheidet über ein 6-Milliarden-Dollar-Jahresbudget und die Arbeit von rund 10'000 Forschern. Im Interview erzählt der 48-jährige Astrophysiker aus Heiligenschwendi bei Thun, wie er es aus einfachsten Verhältnissen ganz nach oben geschafft hat. «Die Sterne waren für mich früh schon ein Symbol für die Weite, die ich zuhause vermisste», sagt der Sohn eines Predigers. Er hält die Raumfahrt für ebenso wichtig wie weitere Fortschritte bei den Erdwissenschaften.
Interview: Mathias Morgenthaler
Foto: Franziska Rothenbühler
Herr Zurbuchen, wie gross war der Rummel, als Sie Ende September zum Wissenschaftsdirektor der Nasa ernannt wurden?
THOMAS ZURBUCHEN: Es gab innert kürzester Zeit Hunderte von Medienanfragen. Ich hatte das komplett unterschätzt. Bei meinem ersten informellen Gespräch mit Journalisten gab ich eine etwas pointierte Antwort auf die Frage, wie die Nasa zu privaten Raumfahrtfirmen wie SpaceX stehe – am nächsten Tag war das die zweitwichtigste Schlagzeile auf dem News-Portal Reddit. Da wurde mir bewusst, wie sorgfältig ich meine Worte künftig abwägen muss. Interviewanfragen habe ich praktisch alle abgelehnt ausser zwei, drei Gesprächen mit Schweizer Medien. Wichtig war mir das Interview mit dem «Thuner Tagblatt» – das war die einzige Chance, meinen Eltern verständlich zu machen, was aus ihrem Sohn geworden ist. Sie riefen dann auch prompt an und sagten mir zum ersten Mal überhaupt, sie seien stolz auf mich.
Wie wird man Forschungschef der Nasa?
Ich hätte mich nie beworben, wenn ich nicht angefragt worden wäre. Aber natürlich hatte ich die Stelle auf dem Radar. Das ist weltweit eine der drei wichtigsten Stellen für Wissenschaftler, vermutlich sogar die einflussreichste. Das Jahresbudget, das ich verantworte, beträgt knapp 6 Milliarden Dollar, gegen 10'000 Wissenschaftler hängen direkt von meinen Entscheidungen ab.
Und Sie hatten keinerlei Zweifel, ob Sie dieser Aufgabe gewachsen sind?
Doch, natürlich. Wer das Gefühl hat, er könne alles, steht unmittelbar am Abgrund. Gleichzeitig hatte ich immer den Drang, mich weiterzuentwickeln, mich nicht von Ängsten bremsen zu lassen, ambitioniert zu leben. Als ich angefragt wurde, suchte ich das Gespräch mit jenen Menschen, denen ich vertraue. Jede Firma hat einen Verwaltungsrat für wichtige strategische Fragen. Ich habe früh ein solches Team aufgebaut für mich, 5 bis 10 Leute, die nicht von mir abhängig sind und die mich gut kennen. Als ich spürte, dass sie es mir alle zutrauten, setzte ich mich vertieft damit auseinander und besprach mich mit meiner Frau. Ich gab ja eine sichere Stelle an der Uni Michigan auf für einen riskanten Job. Das war wie Tag und Nacht, wie am Strand stehen oder auf einem Boot den Wellen trotzen.
Haben Sie im Bewerbungsverfahren ein Assessment, eine Simulation des Ernstfalls durchlaufen?
Nein, aber ich erhielt die Aufgabe, mit einer Gruppe von 10 Leuten in kurzer Zeit acht komplizierte Fragen zu beantworten. So zeigte sich, wer unter Druck gut im Team arbeiten kann. Just in dieser Phase erhielt ich ein zweites Stellenangebot: Ich hätte ein Innovationsdirektor bei Amazon werden können. Als ich zur vermeintlich letzten Interviewrunde bei der Nasa ging, sagte mir Direktor Robert Lightfoot zu meiner Überraschung, er habe sich schon für mich entschieden, ich bekomme die Stelle. So gab es bloss noch ein lockeres Gespräch mit dem obersten Kader über Gott, die Welt und alles dazwischen.
Nasa-Kaderleute reden mit dem künftigen Wissenschaftsdirektor über Gott?
Ja, die wollten einfach wissen, was ich für ein Mensch bin, und da wurde auch Gott zum Thema. Nicht in Form eines Interviews, das wäre illegal, aber im Rahmen eines Gesprächs.
Hat es im Weltbild des Astrophysikers Zurbuchen denn Platz für einen Gott?
Die Frage, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen, ist für alle Menschen zentral – da spielt es keine Rolle, ob jemand Astrophysiker ist oder Betriebswirt. Viele Religionen haben in ihrem Ursprung einen starken Bezug zur Astronomie. Die Menschen fragten sich, ob eine höhere Macht dafür sorgt, dass sich die Sterne organisiert bewegen. Heute wissen wir, dass die Erde sich bewegt, nicht die Sterne. Dass unser Gottesbild und die Wissenschaften sich so weit auseinanderbewegt haben, ist keine zwingende Entwicklung. Ich verstehe Gott als eine höhere Macht, eine Schöpfungskraft. Wenn wir die Natur beobachten, sehen wir Symmetrien, Schönheit, viele Dinge, die sich einem einfachen Zugriff widersetzen und uns tief berühren.
Sie sehen sich demnach nicht als nüchternen Wissenschaftler.
Nein, ich bin wie viele andere Wissenschaftler sehr emotional. Ich erinnere mich gut an den Tag, an dem ich im Büro zum ersten Mal etwas herausfand, was auf der ganzen Welt noch niemand wusste über die Natur. Das ist, als entdeckte man einen Schatz, viel berührender, als wenn man ein menschgemachtes Rätsel löst. Man kommt in solchen Momenten in Berührung mit etwas, das viel grösser und wichtiger ist als der Mensch. So gesehen erlebe ich in der Auseinandersetzung mit der Natur meinen Gottesdienst. Was mich dagegen oft stört an der weit verbreiteten Religiosität ist, wenn ein Gottesbild dazu missbraucht wird, eine Meinung durchzupeitschen, andere zu bekämpfen. Mein Gottesbild ist eines, das die Weite betont, die Grösse der uns überragenden Natur. Ein Gottesbild kann aber auch sehr einengend und belästigend sein. Das ist ein Grund, warum ich nicht sehr aktiv bin in religiösen Kreisen.
Aufgewachsen sind Sie in Heiligenschwendi, als Sohn eines Predigers. Kommt es vor, dass Sie Gott um Beistand bitten bei schwierigen Entscheiden?
Eigentlich nicht oft. Wobei, ich bin damit aufgewachsen, ganz losgekoppelt bin ich nicht von dieser Tradition. Es kann entlastend sein, sich seiner Begrenztheit bewusst zu werden und darauf zu vertrauen, dass wir nicht alles mit eigener Kraft bewältigen müssen. Ich empfinde das nicht als Schwäche. Aber es ist nicht so, dass ich beten würde vor schwierigen Entscheiden. Mindestens so wichtig ist übrigens, sich der Abhängigkeit von den eigenen Leuten bewusst zu sein. Die meisten Mitarbeiter, die ich führe bei der Nasa, haben mehr Erfahrung und mehr Erfolg vorzuweisen in diesem Gebiet als ich. Ich wäre dumm, wenn ich ihnen nicht sehr genau zuhören würde. Es ist eine Frage der Intelligenz, ob man nur aus eigenen Fehlern lernt oder auch aus jenen der anderen.
Sie haben es aus einfachen Verhältnissen an die Spitze der Nasa geschafft. Braucht man einen Plan für eine grosse Karriere?
Ich sehe es ähnlich, wie Steve Jobs es in seiner berühmten Rede von Stanford beschreibt. Entscheidend ist, ob wir das Leben vom Anfang oder vom Ende her betrachten.
Verstehen tut man es oft erst im Rückblick.
Wenn man zurückschaut, sieht man viele Zufälle – wen man wann getroffen hat, welche Optionen sich ergeben, welche Pläne sich zerschlagen haben. Aber das Leben funktioniert nicht so. Es spielt sich in Phasen von fünf bis sieben Jahren ab. Man entscheidet sich für eine Richtung, versucht zu lernen, ein Maximum herauszuholen, sich selber und die Welt zu verbessern. Dann richtet man sich neu aus. Wenn mich Studenten fragen, wie sie den richtigen Job finden, antworte ich immer: «Viel wichtiger ist die Frage, welche Möglichkeiten es nach diesem Job gibt.» Ich habe mir diese Frage selbst immer gestellt. Ich ging nicht in die USA, weil ich Professor werden wollte, sondern weil ich dazulernen und mich breiter vernetzen wollte. Dann unterrichtete ich vorübergehend als Professor, weil es mir ein gutes Gefühl gab, jungen Menschen zu helfen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten.
Aber da wussten Sie schon, dass es Sie weiterziehen wird?
Ja, ich merkte, dass ich als Professor für Weltraumwissenschaften und Raumfahrttechnologie nur 200 von den 40'000 Studenten an meiner Uni persönlich sehen und beeinflussen konnte. Also fragte ich mich: Wie finde ich einen grösseren Hebel? So startete ich die Innovationsprogramme in Michigan, das Zentrum für Unternehmertum. Dennoch ist die Berufung zum Nasa-Direktor keine lineare Weiterentwicklung meiner Karriere. Natürlich verfüge ich über gute wissenschaftliche Grundlagen, habe Instrumente gebaut, Teams gebildet – und weiss mehr über Innovation als die meisten anderen Naturwissenschaftler. Aber es war nicht absehbar für mich, dass dieses Gesamtpaket zu dieser Berufung führen wird.
Also keine Karriereplanung im engeren Sinn?
Nein, ich habe zum Beispiel keine einzige Entscheidung mit Blick auf Geld oder Prestige gefällt. Als promovierter Astrophysiker muss ich mir zum Glück keine Sorgen machen, ob ich für mich und meine Familie sorgen kann. Wer vor der Sorge ums Geld befreit ist, tut gut daran, sich auf die intrinsische Motivation zu konzentrieren. Jene, welche nach Ruhm oder Optimierung des Einkommens streben, machen sich hochgradig abhängig.
Sie waren offensichtlich sehr fleissig, das zeigt allein der 25 Seiten umfassende Lebenslauf mit allen Publikationen. Sie waren auch talentiert, haben Chemieprüfungen in wenigen Minuten gelöst. Und doch wirkt es so, als wäre ein anderer Punkt entscheidend gewesen: dass Sie als Kind so wenig Optionen hatten.
Nur wenige reden darüber, aber einer der grössten Antreiber von uns allen ist Furcht vor dem Versagen. Bei mir dauerte es nach dem Wechsel in die USA mindestens 15 Jahre, bis ich keine Albträume mehr hatte und nicht mehr aufwachte mit dem schrecklichen Gefühl, ich sei wieder im abgeschlossenen Leben meiner Jugend. So geht es vielen sehr erfolgreichen Menschen, ich weiss das aus unzähligen Gesprächen. Von den Erfolgreichsten fühlt sich niemand total sicher, allen sitzt mehr oder weniger die Angst im Nacken.
Ihr Vater war Evangelist in einer Freikirche in Heiligenschwendi und förderte Sie kaum.
Er liess mich zwar immer machen. Als ich mich aber entschied, das Gymnasium zu besuchen, und dann zur Universität ging, wurde unsere innere und auch die geographische Distanz immer grösser. Wir lebten zunehmend in getrennten Welten. Meine Eltern waren zum Beispiel nie bei meinen Promotionsfeiern. Das ist manchmal schmerzhaft, aber es war auch ein starker Antrieb. Ich wusste schon in der 4. Klasse, dass ich weg will, und die Sterne waren für mich früh schon ein Symbol für die Weite, die ich zuhause vermisste. In den ersten 16 Lebensjahren war ich nie im Kino, nie in einem Theater, nur ein paar Mal in Bern und ausser in Deutschland nie im Ausland.
Hat Ihr Vater also Ihre Karriere begünstigt, obwohl er Sie nicht gefördert hat? Manche Psychologen sind ja überzeugt, dass nicht unsere Talente, sondern unsere frühen Verletzungen darüber entscheiden, wie weit wir es bringen.
Ich kenne diese Theorie und ich halte das für plausibel, ja. Das heisst auch, dass wir unseren Kindern keinen Gefallen tun, wenn wir ihnen alle Probleme aus dem Weg räumen und alles für sie organisieren.
War das später hilfreich, dass Sie sich das alles hart erkämpfen mussten?
Ja, ich bin arm aufgewachsen und lernte früh, dass niemand für mich Türen öffnet, dass ich selber aufstehen muss, wenn ich hinfalle. Ich musste hart für meinen ersten Computer arbeiten, jobbte in der Fabrik und auf dem Bau und lernte dort in jungen Jahren, wie wichtig Teamwork und sorgfältiges Arbeiten sind. Und ich wurde in meinem dritten Job vom Chef betrogen und habe seither ein ausgeprägtes Gespür für Integrität. Wenn jemand nicht aufrichtig und verlässlich ist, trenne ich mich sofort von ihm. Das Aufwachsen in diesem Bergdorf oberhalb des Thunersees hatte also auch sein Gutes. Wenn man Bergbauern sieht, versteht man sofort, dass ohne harte Arbeit nichts funktioniert. Und dass man einander helfen muss. Ich wusste immer: Wenn du mit den Aufgaben fertig bist, hilfst du den Nachbarn beim Heuen. Deshalb haben mich später bei der Arbeit 16-Stunden-Tage oder 80-Stunden-Wochen nie gestört.
Sie sagen in Vorträgen, Ihr Ziel sei es, die Welt durch Forschung besser zu machen. Inwiefern tun Sie das, wenn Sie bei der Nasa Raumfahrtmissionen planen?
Kennen Sie das Jungfraujoch? Fast alle kennen es, als höchstgelegenen Ort, wo eine Eisenbahn hinkommt, als Sehnsuchtsort für Millionen Touristen aus aller Welt, Top of Europe. Aber wissen Sie was? Das Joch ist ein Misserfolg. Denn der erste Plan war, eine Station auf der Jungfrau zu errichten. Dieser Misserfolg hat das Leben von Zehntausenden von Menschen im Berner Oberland verbessert. Wenn wir Grundlagenforschung machen, geht es um diese Ambition, auf die Jungfrau zu kommen, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Gute Forschung stellt sich den einfachen, tiefen Fragen, die so schwierig zu beantworten sind. Und sie zieht uns vorwärts ins Unbekannte, katapultiert uns aus dem Gewohnten und Überschaubaren hinaus. In den letzten 100 Jahren hat sich gezeigt: Die Auseinandersetzung mit den scheinbar zwecklosen Fragen hat unser Leben so entscheidend verbessert wie nichts anderes.
Woran denken Sie?
Das eindrücklichste Beispiel bleibt Albert Einsteins Arbeit zwischen 1903 und 1905 hier in Bern. Er setzte sich mit einfachen Fragen auseinander: was Relativität bedeutet, wie Zeit von einem System ins andere übersetzt wird, wie Materie funktioniert. Das war Grundlagenforschung ohne ersichtlichen Nutzen. Die Antworten, die er gefunden hat, haben die Welt verändert. Wenn ich heute ins Inselspital gehe, sind sicher drei, wahrscheinlich fünf von zehn Instrumenten auf Einsteins Erkenntnisse aufgebaut. Das ist die grosse Kraft von Forschung. Das Gleiche gilt für die Mondlandung. Sie war zwar in erster Linie ein politisches Kräftemessen, verursachte aber eine Revolution in der Technologie, quasi als Nebeneffekt. Die Arbeit am Cern in Genf wird ähnliche Effekte haben und hat sie schon heute. Man sprengt die Box des Gewohnten und entdeckt draussen Dinge, nach denen man gar nicht hätte suchen können.
Es geht Ihnen also um viel mehr als eine ständige Basis auf dem Mond oder eine bemannte Expedition auf den Mars?
Ja. Die Raumfahrt hat wie beschrieben wichtige Auswirkungen auf die Lebensqualität auf der Erde. Dazu kommen die Erdwissenschaften, die seit der Gründung ein wichtiger Pfeiler der Nasa sind. Da geht es noch viel direkter um die Verbesserung unserer Lebensbedingungen, zum Beispiel um bessere Wetterprognosen, um zuverlässige Voraussagen von Erdbeben, Wirbelstürmen oder Tsunamis. Jeder Wettersatellit, der in den USA eingeführt wird, durchläuft unser Nasa-Programm. Ansonsten gilt für die Forschungsprogramme, was auch für Firmen gilt: die gefährlichsten sind die, die bloss das nächste Quartal im Fokus haben. Die werden kurzfristig vielleicht glänzen, mittelfristig aber untergehen. Wir müssen beides tun: die heutigen Probleme anpacken und uns mit den schwierigen Fragen der Zukunft befassen. Beim zweiten Punkt steht die Zukunft unserer Kinder auf dem Spiel.
Für wie wichtig halten Sie dabei die Fragen, ob wir Menschen auch auf anderen Planeten leben können und ob es bereits heute Leben gibt auf anderen Planeten?
Das sind diese einfachen Fragen, die unglaublich schwierig zu beantworten sind. Ich halte sie für sehr wichtig. Und wir machen enorme Fortschritte, in den letzten 20 Jahren haben wir mehr über den Ursprung des Lebens gelernt als in der gesamten Zeit davor. In den nächsten 20 Jahren werden wir einige dieser Fragen endgültig beantworten können – vermutlich auch die Frage, ob es Leben gibt auf anderen Planeten. Wenn wir keine konkrete Antwort finden, wird sich unser Bild von Lebewesen in dieser Zeit fundamental geändert haben.
Hat nicht jede Generation das Gefühl, das Lernen beschleunige sich gerade enorm?
Der Fortschritt war zuletzt wirklich gewaltig. 1995 beobachteten wir erstmals Planeten um einen anderen Stern herum. Heute kennen wir rund 4500 solche Systeme und rund zwei Dutzend erdähnliche Planeten. Das alles in 20 Jahren! Und wir machen jede Woche neue Entdeckungen. Es gibt wirklich keinen Grund mehr anzunehmen, wir Erdbewohner seien das einzige Leben im Universum.
Werden Ihre Enkel wählen können, ob sie auf der Erde oder auf einem anderen Planeten leben wollen?
Zunächst ist es wichtig, dass wir es schaffen, unseren Enkeln eine intakte Erde zu hinterlassen. Genauso wichtig ist es, dass wir lernen, auf dem Mars zu landen. Werden wir auf dem Mars leben in 20 Jahren? Wir werden sicher dort gelandet sein, wahrscheinlich mit Menschen an Bord. Werden Leute über Jahre auf dem Mars leben? Schwer zu sagen. Ich denke schon, aber sicher bin ich mir nicht. Können und werden Familien dauerhaft auf dem Mars wohnen? In 20 Jahren vielleicht nicht, in 30 wahrscheinlich schon. Aber die Forschung ist voller Überraschungen. Wenn sich unsere Voraussagen über 10 oder 20 Jahre bewahrheiten, müssen wir uns vorwerfen, schlecht geforscht zu haben.
Sie haben an der Tagung «Spirit of Bern» zum Thema Unternehmertum referiert. Wären wir in der Schweiz innovativer, wenn es uns weniger gut ginge?
In Michigan setzt der grosse Innovationsschub ein, als durch die Wirtschaftskrise die Existenzgrundlage einer ganzen Gegend wegbrach. In der Schweiz ist das ähnlich. In den Bergregionen bangen viele Menschen ums finanzielle Überleben, sie müssen neue Geschäftsmodelle finden. Hoher Veränderungsdruck begünstigt Innovationen, aber wir sollten in der Schweiz dennoch dankbar sein, dass die Schweiz ein funktionierendes Sozialversicherungs- und Gesundheitssystem hat. Wichtig ist, dass gerade die jungen Menschen begreifen, dass ein gutes Leben nicht dadurch definiert wird, dass man einen sicheren Job hat und um 17 Uhr nach Hause kann, um dort packende Serien am TV zu schauen. Wir brauchen Vorbilder, die zeigen, wie wichtig es ist, Risiken einzugehen, etwas Neues zu bauen, Stellen zu schaffen.
Was vermitteln Sie Ihren Kindern in dieser Hinsicht?
Wir wissen aus Studien, dass in der Schulzeit Anpassung und korrekte Wissenswiedergabe belohnt werden und die Kreativität darunter leidet. Ich versuche, da täglich Gegensteuer zu geben, etwa durch einfache Übungen in divergentem Denken. So frage ich meine Kinder zum Beispiel, wer in 3 Minuten mehr Ideen hat, was man mit einem Salz- und Pfefferstreuer alles anstellen könnte. Je schneller Lehrer, Professoren und Führungskräfte lernen, statt dem Richtigen das Wichtige in den Fokus zu nehmen und auch widersprüchliche Antworten zuzulassen, desto besser gedeiht unternehmerisches Denken und Handeln.
Dieses beinhaltet aber auch, das Risiko des Scheiterns in Kauf zu nehmen.
Deshalb halte ich Sport für eine hervorragende Lebensschule. Beim Sport verliert man mindestens jedes zweite Mal. Das ärgert einen, aber man merkt auch, dass es nicht das Ende ist. Verlieren ist nicht so schlimm, wenn man es zum Anlass nimmt, mehr zu üben und besser zu werden. Ich ging hier in Bern der Aare entlang joggen. Als Läufer weiss ich: Mit Talent kommst du nicht weit. Es kommt darauf an, regelmässig zu üben und das zu geniessen. Die meisten Dinge sind lernbar. Aber wer aus Angst nie an den Start geht, kommt auch nicht ins Ziel. Deshalb ist meine wichtigste Aufgabe, rasch herauszufinden, welche Wände in meinem neuen Job echt sind und welche nur eine Täuschung. Die meisten Wände, von denen wir uns begrenzen lassen, sind Trugbilder; da können wir durchgehen und es tut nicht einmal weh.
4. Februar 2017